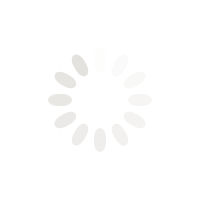J. M. Coetzee – Nobelvorlesung
English
Swedish
French
German
Er und sein Mann
Um jedoch auf meinen neuen Gefährten zurückzukommen, so gefiel mir dieser außerordentlich. Ich erachtete es für meine Pflicht, ihn in allem zu unterweisen, was ihn nützlich und geschickt machen könnte. Besonders gab ich mir Mühe, ihn sprechen und mich verstehen zu lehren. Er war der aufgeweckteste Schüler, den man sich denken kann.
— Daniel Defoe, Robinson Crusoe *
Boston, an der Küste von Lincolnshire, ist eine hübsche Stadt, schreibt sein Mann. Sie hat den höchsten Kirchturm von ganz England; Lotsen benutzen ihn als Navigationshilfe. Die Gegend um Boston ist Sumpfland. Es wimmelt dort von Rohrdommeln, unheilverkündende Vögel, die ein dumpfes Brüllen von sich geben, das meilenweit zu hören ist, wie der Knall eines Schusses.
Das Sumpfland beherbergt auch viele andere Vögel, schreibt sein Mann, Enten und Stockenten, Krickenten und Pfeifenten. Um die zu fangen, züchten die Leute vom Sumpfland zahme Enten, die sie Lockenten nennen.
Diese Sümpfe heißen fens und sind Feuchtgebiete. Es gibt Feuchtgebiete in ganz Europa, auf der ganzen Welt, aber sie heißen dort nicht fens, fen ist ein englisches Wort, es wandert nicht.
Diese Lincolnshire-Lockenten, schreibt sein Mann, werden in Fangteichen gezüchtet und durch Handfütterung zahm gehalten. Wenn dann die rechte Jahreszeit da ist, werden sie ins Ausland, nach Holland und Deutschland, geschickt. In Holland und Deutschland treffen sie sich mit anderen ihresgleichen, und wenn sie sehen, was für ein elendes Leben diese holländischen und deutschen Enten fristen, weil ihre Flüsse im Winter zufrieren und ihre Äcker mit Schnee bedeckt sind, versäumen sie nicht, ihnen in einer Art Sprache, mit der sie sich verständlich machen, mitzuteilen, dass es in England, wo sie herkommen, ganz anders ist: Englische Enten haben Küsten, die ihnen genug sättigende Nahrung bieten, Gezeiten, die ungehindert in die Flüsse hinein strömen; sie haben Seen, Quellen, offene Teiche und geschützte Teiche; auch Äcker voller Körner, die von den Ährenlesern liegen gelassen wurden; und keinen Frost oder Schnee, oder nur ganz wenig.
Durch diese Angaben, schreibt er, die ganz in der Entensprache gemacht werden, ziehen die Lockenten riesige Scharen Wasservögel an und entführen sie sozusagen. Sie führen sie von Holland und Deutschland übers Meer und lassen sich mit ihnen auf den Fangteichen im Sumpfland von Lincolnshire nieder, wobei sie unablässig in ihrer Sprache quaken und schnattern und ihnen sagen, das seien die Teiche, von denen sie ihnen erzählt haben, wo sie ruhig und sicher leben sollen.
Und während sie damit beschäftigt sind, kriechen die Entenfänger, die Herren der Lockenten, in Verstecke, die sie im Sumpfland aus Ried errichtet haben, und werfen aus der Deckung heraus Körner aufs Wasser; und die Lockenten folgen ihnen und ziehen ihre ausländischen Gäste nach. Und so führen sie ihre Gäste in zwei oder drei Tagen immer enger werdende Wassergräben hinauf und rufen ihnen die ganze Zeit zu: Seht doch, wie gut wir in England leben!, bis sie an einen Ort kommen, wo man Netze aufgespannt hat.
Dann schicken die Entenfänger ihren Jagdhund vor, den man perfekt darauf abgerichtet hat, hinter den Vögeln herzuschwimmen und dabei zu bellen. Zu Tode erschreckt von diesem Untier fliegen die Enten auf, werden aber durch die oben aufgespannten Netze ins Wasser zurück gezwungen und müssen daher unterm Netz schwimmen oder umkommen. Aber das Netz wird immer enger, wie ein Sacknetz, und an seinem Ende stehen die Entenfänger, die ihre Gefangenen eine nach der anderen herausholen. Die Lockenten werden gestreichelt und gelobt, was aber ihre Gäste angeht, so werden sie auf der Stelle mit Knüppeln erschlagen und gerupft und zu Hunderten und Tausenden verkauft.
Diese ganzen Neuigkeiten von Lincolnshire schreibt sein Mann in sauberer, flinker Schrift, mit Federkielen, die er jeden Tag vor einem neuen Kampf mit der Seite mit seinem kleinen Taschenmesser anspitzt.
In Halifax, schreibt sein Mann, stand – bis man ihn in der Regierungszeit Jakob I. entfernte – ein Hinrichtungsapparat, der folgendermaßen funktionierte: Der Verurteilte wurde mit dem Kopf auf den unteren Querbalken oder die Mulde des Schafotts gelegt; dann schlug der Henker einen Stift heraus, der das schwere Fallbeil oben hielt. Das Beil fuhr ein kirchentürhohes Gestell herab und enthauptete den Mann so sauber wie ein Schlachtmesser.
Es gab aber einen Brauch in Halifax, dass der Verurteilte, wenn er zwischen dem Herausschlagen des Stiftes und dem Herabfahren des Beils aufspringen, den Hang hinunterlaufen und über den Fluss schwimmen konnte, ohne vom Henker eingefangen zu werden, freigelassen werden würde. Aber solange der Apparat in Halifax stand, ist das in all den Jahren nie geschehen.
Er (jetzt nicht sein Mann, sondern er) sitzt in seinem Zimmer am Hafen von Bristol und liest das. Er wird langsam älter, man kann fast schon sagen, dass er mittlerweile ein alter Mann ist. Seine Gesichtshaut, einst von der Tropensonne fast schwarzbraun gebrannt, bevor er aus Palmblattstreifen einen Sonnenschirm anfertigte, ist nun blasser, doch immer noch ledern wie Pergament; auf der Nase hat er von der Sonne eine wunde Stelle, die nicht heilen will.
Der Sonnenschirm steht immer noch hier in seinem Zimmer in einer Ecke, aber der Papagei, den er mitgebracht hatte, ist gestorben. Armer Robin!, kreischte der Papagei auf der Schulter seines Herrn sitzend, Armer Robin Crusoe! Wer rettet den armen Robin? Seine Frau konnte das Zetern des Papageis nicht ertragen, Armer Robin tagaus, tagein. Ich werd ihm den Hals umdrehn, sagte sie, aber sie traute sich nicht.
Als er mit dem Papagei, dem Sonnenschirm und der Schatztruhe von seiner Insel nach England zurückkehrte, lebte er eine Weile recht friedlich mit seiner alten Frau auf dem Gut, das er in Huntingdon gekauft hatte, denn er war ein reicher Mann geworden, und nach der Veröffentlichung des Buchs über seine Abenteuer war er noch reicher. Aber die Jahre auf der Insel und danach die Jahre des Umherreisens mit seinem Diener Freitag (armer Freitag, jammert er vor sich hin, kreisch, kreisch, denn der Papagei sprach nie Freitags Namen, nur seinen) ließen ihm das Leben eines Grundbesitzers jetzt langweilig werden. Und, um bei der Wahrheit zu bleiben, das Eheleben war ebenfalls eine herbe Enttäuschung. Er zog sich immer öfter in die Stallungen zurück, zu seinen Pferden, die Gott sei Dank nicht schwatzten, sondern bei seinem Kommen leise wieherten, um ihm zu zeigen, dass sie wussten, wer er war, und dann still waren.
Von seiner Insel kommend, wo er vor Freitags Ankunft ein schweigsames Leben geführt hatte, schien es ihm nun, als würde auf der Welt zu viel geredet. Im Bett neben seiner Frau war ihm zumute, als schütte man ihm unter nicht enden wollendem Gerassel und Gepolter Kieselsteine über den Kopf, wenn er sich nichts weiter wünschte, als zu schlafen.
Als seine alte Frau ihren Geist aufgab, trug er daher Trauer, aber er war nicht betrübt. Er begrub sie, und nach einer angemessenen Zeit mietete er am Hafen von Bristol dieses Zimmer im Lustigen Seebären und überließ die Verwaltung seines Guts in Huntingdon seinem Sohn. Er nahm nur den Sonnenschirm von der Insel, die ihn berühmt gemacht hatte, und den toten Papagei auf seiner Stange und ein paar unentbehrliche Dinge mit und hat seither hier immer allein gelebt; bei Tag schlendert er seine Pfeife rauchend über die Piers und Kais und starrt übers Meer nach Westen, denn er hat noch scharfe Augen. Und seine Mahlzeiten lässt er sich aufs Zimmer bringen; denn er hat keine Freude an gesellschaftlichem Umgang, da er sich auf der Insel an die Einsamkeit gewöhnt hat.
Er liest nicht, er hat die Lust dazu verloren; aber durch das Aufschreiben seiner Abenteuer ist ihm das Schreiben zur Gewohnheit geworden, es ist eine recht angenehme Freizeitbeschäftigung. Abends beim Schein der Kerzen holt er seine Papiere hervor und spitzt seine Federkiele an und schreibt ein oder zwei Seiten von seinem Mann, dem Mann, der von den Lockenten in Lincolnshire berichtet, und von der großen Todesmaschine in Halifax, der man entrinnen kann, wenn man vor dem Fallen des schrecklichen Beils aufspringen und den Hang hinunterlaufen kann, und von einer Reihe anderer Dinge. Von jedem Ort, den er besucht, berichtet er, das ist die vordringlichste Beschäftigung seines so geschäftigen Mannes.
Er, Robin, den der Papagei den armen Robin zu nennen pflegte, schlendert an der Hafenmauer entlang, denkt über den Apparat von Halifax nach, lässt einen Kieselstein fallen und lauscht. Eine Sekunde, weniger als eine Sekunde, ehe er das Wasser erreicht. Gottes Gnade ist schnell bereit, aber könnte nicht das große Fallbeil aus gehärtetem Stahl, das schwerer als ein Kieselstein und gut geschmiert ist, schneller sein? Wie sollen wir dem Beil jemals entkommen? Und was für ein Mensch ist das bloß, der so geschäftig quer durch das Königreich hierhin und dahin eilt, von einem Schauspiel des Todes zum nächsten (Erschlagen, Köpfen), und einen Bericht nach dem anderen schickt?
Ein Geschäftsmann, denkt er bei sich. Er soll ein Geschäftsmann sein, zum Beispiel ein Getreidehändler oder ein Lederwarenhändler; oder ein Hersteller und Lieferant von Dachziegeln an einem Ort, wo es viel Lehm gibt, zum Beispiel Wapping, der durch sein Gewerbe viel reisen muss. Mache ihn wohlhabend, gib ihm eine Frau, die ihn liebt, die nicht zu viel schwatzt und ihm Kinder schenkt, hauptsächlich Töchter; gib ihm ein gewisses Maß an Glück; lasse dann sein Glück ein jähes Ende finden. Die Themse tritt in einem Winter über die Ufer, die Öfen, in denen man die Ziegel trocknet, werden weggespült, oder die Getreidespeicher oder die Gebäude der Lederwarenfabrik; er, sein Mann, ist ruiniert, Gläubiger fallen über ihn her wie Schmeißfliegen oder wie Krähen, er muss sein Zuhause, seine Frau, seine Kinder fluchtartig verlassen und sich verkleidet und unter falschem Namen in den Elendsquartieren der Beggars Lane verstecken. Und das alles – die Flut, der wirtschaftliche Ruin, die Flucht, die Mittellosigkeit, die Lumpen, die Einsamkeit – das alles soll ein Sinnbild des Schiffbruchs und der Insel sein, wo er, der arme Robin, sechsundzwanzig Jahre lang von der Welt abgeschieden war, bis er beinahe verrückt wurde (und wer sagt denn, dass er es nicht bis zu einem gewissen Grad geworden ist?).
Oder aber der Mann soll ein Sattler mit einem Haus und einem Laden und einem Lager in Whitechapel sein, ein Muttermal auf dem Kinn und eine Frau haben, die ihn liebt und nicht schwatzt und ihm Kinder schenkt, hauptsächlich Töchter, und die ihn sehr glücklich macht, bis die Pest über die Stadt hereinbricht, es ist das Jahr 1665, das Große Feuer von London hat noch nicht gewütet. Die Pest bricht über London herein: täglich steigt in einem Pfarrbezirk nach dem anderen die Zahl der Toten, bei Arm und Reich, denn die Pest fragt nicht nach dem Stand, sein ganzer weltlicher Reichtum wird diesen Sattler nicht retten. Er schickt seine Frau mit den Töchtern aufs Land und schmiedet Pläne für die eigene Flucht, führt sie dann aber nicht aus. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, daß du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, liest er, als er die Bibel an beliebiger Stelle aufschlägt, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pestilenz, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die im Mittage verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen.
Aus diesem Zeichen Mut schöpfend, einem Zeichen für sicheres Geleit, bleibt er im seuchenbefallenen London und macht sich daran, Berichte zu schreiben. Auf der Straße traf ich eine Menschenmenge an, schreibt er, und eine Frau in ihrer Mitte zeigt plötzlich zum Himmel. Seht doch, schreit sie, ein Engel in weißen Gewändern schwingt ein flammendes Schwert! Und die Menschen in der Menge nicken einander zu, Ja, es stimmt, sagen sie: ein Engel mit einem Schwert! Aber er, der Sattler, sieht keinen Engel, kein Schwert. Er sieht nur eine seltsam geformte Wolke, die von der Sonne auf der einen Seite heller beschienen wird als auf der anderen.
Es ist eine Allegorie!, schreit die Frau auf der Straße; aber er kann beim besten Willen keine Allegorie sehen. So steht es in seinem Bericht.
An einem anderen Tag geht sein Mann, der einmal Sattler war, aber jetzt ohne Beschäftigung ist, in Wapping am Fluss entlang und beobachtet, wie eine Frau von ihrer Haustür aus einem Mann, der ein kleines Fischerboot rudert, zuruft: Robert! Robert!, ruft sie; und wie der Mann dann ans Ufer rudert und aus dem Boot einen Sack hebt, den er auf einen Stein am Flussrand legt; und wie die Frau, von tiefem Gram gezeichnet, zum Fluss herunterkommt, den Sack nimmt und ihn heimträgt.
Er spricht den Mann an und redet mit ihm. Robert erzählt ihm, dass er der Ehemann der Frau ist und dass der Sack den Wochen-Vorrat für sie und ihre Kinder enthält, Fleisch und Mehl und Butter; aber dass er sich nicht näher heran traut, denn sie alle, die Frau und die Kinder, tragen die Pest in sich; und dass es ihm das Herz bricht. Und das alles – der Mann Robert und seine Frau, die durch Rufe über das Wasser Zwiesprache miteinander halten, und der am Ufer zurückgelassene Sack – steht gewiss für sich, doch es steht auch als Sinnbild für seine, Robinsons, Einsamkeit auf der Insel, wo er in seiner Stunde der schwärzesten Verzweiflung seinen Lieben daheim in England über das Meer hinweg zurief, sie mögen ihn retten, und bei anderen Gelegenheiten zum Wrack hinausschwamm, um Vorräte zu suchen.
Ein weiterer Bericht aus dieser Zeit des Jammers. Ein Mann, der die Schmerzen nicht länger ertragen kann, die ihm die Schwellungen in der Leistengegend und unter den Achseln bereiten, die Zeichen der Pest sind, rennt brüllend und splitterfasernackt auf die Straße, hinaus auf die Harrow Alley in Whitechapel, wo sein Mann, der Sattler, mitansieht, wie er hüpft und springt und Tausend seltsame Bewegungen macht, während ihm Frau und Kinder nachlaufen und ihm zurufen, er solle zurückkommen. Und dieses Hüpfen und Springen ist eine Allegorie seines eigenen Hüpfens und Springens nach der Katastrophe des Schiffbruchs, als er den Strand nach einer Spur von seinen Kameraden gründlich abgesucht und keine gefunden hatte, außer zwei Schuhen, die nicht zusammengehörten, und begriffen hatte, dass er allein auf einer wilden Insel gestrandet war, höchstwahrscheinlich dem Untergang geweiht, ohne Aussicht auf Rettung.
(Aber wovon singt er insgeheim noch, fragt er sich verwundert, dieser arme geplagte Mann, von dem er liest, außer von seiner Verlassenheit? Was ruft er, über die Meere und über die Jahre hinweg, aus seinem privaten Feuer?)
Vor einem Jahr hat er, Robinson, einem Seemann zwei Guineen bezahlt für einen Papagei, den der Seemann, wie er sagte, aus Brasilien mitgebracht hatte – einen Vogel, der nicht so prächtig wie sein eigenes heißgeliebtes Tier war, aber dennoch wunderschön, mit grünem Gefieder und einer scharlachroten Haube und auch sehr sprechfreudig, wenn man dem Seemann glauben wollte. Und wirklich saß der Vogel im Gasthauszimmer auf seiner Stange, mit einer kleinen Kette am Bein, falls er den Versuch machen sollte, wegzufliegen, und sprach die Worte Armer Poll! Armer Poll! immer und immer wieder, bis er ihn zudecken musste; aber man konnte ihm kein anderes Wort beibringen, Armer Robin! zum Beispiel, weil er vielleicht zu alt dafür war.
Der arme Poll blickt durch das schmale Fenster auf die Mastspitzen, und über die Mastspitzen hinweg auf die grauen Wogen des Atlantiks: Was ist das für eine Insel, so kalt, so trüb, fragt der arme Poll, auf der ich gestrandet bin? Wo warst du, mein Retter, in meiner Stunde der Not?
Ein Mann schläft in einem Hauseingang in Cripplegate ein (wieder ein Bericht seines Mannes), da er betrunken ist und es schon tiefe Nacht ist. Der Totenkarren macht die Runde (wir sind noch im Pestjahr), und die Nachbarn legen den Mann, weil sie ihn für tot halten, auf den Karren zu den Leichen. Schließlich kommt der Karren bei der Totengrube in Mountmill an, und der Fuhrmann, das Gesicht gänzlich verhüllt zum Schutz gegen die Ausdünstung, packt ihn, um ihn in die Grube zu werfen; und er wacht auf und wehrt sich in seiner Verwirrung. Wo bin ich?, fragt er. Gleich wirst du mit den Toten begraben, sagt der Fuhrmann. Dann bin ich also tot?, fragt der Mann. Und das ist auch ein Sinnbild für ihn auf seiner Insel.
Einige Londoner gehen weiter ihren Geschäften nach, weil sie glauben, sie wären gesund und würden verschont werden. Aber insgeheim haben sie die Pest im Blut: wenn die Seuche ihr Herz erreicht, fallen sie auf der Stelle tot um, so berichtet sein Mann, wie vom Blitz getroffen. Und das ist ein Sinnbild des Lebens selbst, des ganzen Lebens. Gebührende Vorbereitung. Wir sollten uns gebührend auf den Tod vorbereiten, sonst werden wir gefällt, wo wir stehen. Wie er, Robinson, erkennen musste, als er plötzlich eines Tages auf seiner Insel einen menschlichen Fußabdruck im Sand entdeckte. Es war ein Abdruck, und daher ein Zeichen: für einen Fuß, für einen Menschen. Aber es war auch das Zeichen für viel mehr. Du bist nicht allein, besagte das Zeichen; und auch: Ganz gleich, wie weit du segelst, ganz gleich, wo du dich versteckst, man wird dich aufspüren.
Im Pestjahr, schreibt sein Mann, verließen andere aus großer Furcht alles, ihre Häuser, ihre Frauen und Kinder, und flohen so weit von London weg, wie sie konnten. Als die Pest vorüber war, wurde ihre Flucht von allen Seiten als jämmerliche Feigheit verdammt. Aber, schreibt sein Mann, wir vergessen, welcher besondere Mut vonnöten war, um der Pest standzuhalten. Es war nicht einfach der Mut eines Soldaten, der eine Waffe in die Hand nimmt und den Feind angreift: es war, als ob man den Tod selbst auf seinem fahlen Pferd angriffe.
Selbst in Hochform sprach sein Inselpapagei, der geliebtere von beiden, kein Wort, das ihm nicht sein Herr und Meister beigebracht hatte. Wie kommt es dann, dass dieser Mann, sein Mann, der eine Art Papagei ist und nicht sehr geliebt wird, genauso gut wie oder besser als sein Herr und Meister schreibt? Denn er führt die Feder sehr geschickt, dieser Mann, sein Mann, das ist nicht zu bezweifeln. Als ob man den Tod selbst auf seinem fahlen Pferd angriffe. Er hingegen war geschickt im Rechnen und in der Buchführung, was er im Kontor gelernt hatte, nicht im Formulieren. Der Tod selbst auf seinem fahlen Pferd – das sind Worte, die ihm nicht einfallen würden. Nur wenn er sich diesem Mann, seinem Mann, ausliefert, kommen solche Worte.
Und Lockenten: Was wusste er, Robinson, von Lockenten? Gar nichts, bis sein Mann ihm Berichte zu schicken begann. Die Lockenten der Sumpfgebiete von Lincolnshire, der große Hinrichtungsapparat in Halifax: Berichte von einer ausgedehnten Rundreise, die sein Mann offenbar auf der britischen Insel macht, was ein Sinnbild seiner eigenen Reise im selbstgebauten Boot um seine Insel ist, der Reise, die zeigte, dass es eine andere Seite der Insel gab, felsig und düster und unwirtlich, die er danach nie mehr besucht hat, obwohl Kolonisten, falls solche einmal auf die Insel kommen sollten, sie vielleicht erforschen und besiedeln werden; und auch das ist ein Sinnbild – für die dunkle Seite der Seele und die lichte Seite.
Als die ersten Scharen von Plagiatoren und Nachahmern sich auf seine Inselchronik stürzten und der Öffentlichkeit ihre frei erfundenen Geschichten vom Leben eines Schiffbrüchigen unterschoben, sah er in ihnen nicht mehr und nicht weniger als eine Horde Kannibalen, die über sein Fleisch, das heißt, sein Leben, herfielen; und er hatte keine Bedenken, das auch zu sagen. Als ich mich gegen die Kannibalen verteidigte, die mich erschlagen, braten und verschlingen wollten, schrieb er, glaubte ich mich gegen die Sache selbst zu verteidigen. Ich ahnte kaum, schrieb er, dass diese Kannibalen nur Sinnbilder einer noch teuflischeren Gier waren, die an der Wahrheit selbst nagen würde.
Aber bei weiterem Nachdenken schleicht sich nun in seine Brust allmählich ein gewisses Mitgefühl für seine Nachahmer. Denn es scheint ihm jetzt, als gebe es nur eine Hand voll Geschichten auf der Welt; und wenn es den Jungen verboten sein soll, die Alten auszubeuten, dann müssten sie für immer schweigen.
So berichtet er bei der Schilderung seiner Inselabenteuer, wie er eines Nachts in panischer Angst aufwachte und überzeugt davon war, der Teufel in Gestalt eines riesigen Hundes läge auf ihm in seinem Bett. Deshalb sprang er auf, packte ein Entermesser und hieb damit nach rechts und links, um sich zu verteidigen, während der arme Papagei, der neben seinem Bett schlief, erschreckt kreischte. Erst viele Tage später begriff er, dass weder ein Hund noch der Teufel auf ihm gelegen hatten, sondern dass er eine vorübergehende Lähmung gehabt hatte, und da er sein Bein nicht bewegen konnte, daraus gefolgert hatte, irgendein Wesen läge auf ihm. Und die Lehre aus diesem Vorfall war offenbar, dass alle Leiden, einschließlich des Schlaganfalls, vom Teufel kommen, ja der Teufel selber sind; dass eine Heimsuchung durch Krankheit als Heimsuchung durch den Teufel versinnbildlicht werden kann, oder durch einen Hund als Sinnbild des Teufels, und umgekehrt, dass die Heimsuchung eine Krankheit versinnbildlicht, wie in der Pestchronik des Sattlers; und dass deshalb keiner, der Geschichten über den Teufel oder die Pest schreibt, sofort als Fälscher oder Dieb abgetan werden sollte.
Als er vor Jahren den Entschluss fasste, seine Inselgeschichte zu Papier zu bringen, stellte er fest, dass die Worte nicht kamen und die Feder ihm nicht gehorchen wollte, dass selbst seine Finger steif und unwillig waren. Aber Tag für Tag, nach und nach, meisterte er das Geschäft des Schreibens, und als er dann seine Abenteuer mit Freitag im eisigen Norden beschrieb, floss ihm der Text schließlich leicht aus der Feder, sogar ohne großes Nachdenken.
Diese alte Leichtigkeit des Schreibens hat ihn leider im Stich gelassen. Wenn er sich an den kleinen Schreibtisch vor das Fenster setzt, das auf den Hafen von Bristol blickt, erscheint ihm seine Hand so ungeschickt und die Feder so ungewohnt wie eh und je.
Ob er, jener andere, sein Mann, das Geschäft des Schreibens leichter findet? Seine Geschichten von Enten und Hinrichtungsapparaten und London während der Pest sind angenehm flüssig geschrieben; aber das waren seine eigenen Geschichten auch einmal. Vielleicht beurteilt er ihn falsch, jenen agilen kleinen Mann mit dem flinken Gang und dem Muttermal am Kinn. Vielleicht sitzt er gerade jetzt allein in einem gemieteten Zimmer, irgendwo in diesem großen Königreich, taucht die Feder ein, taucht sie noch einmal ein, voller Zweifel, Vorbehalte und Bedenken.
Als was sollen sie auftreten, dieser Mann und er? Als Herr und Sklave? Als Brüder, Zwillingsbrüder? Als Waffenbrüder? Oder als Feinde, Widersacher? Welchen Namen soll er diesem Namenlosen geben, mit dem er seine Abende und manchmal auch seine Nächte verbringt, der nur am Tag abwesend ist, wenn er, Robin, über die Kais wandert und die kürzlich eingelaufenen Schiffe besichtigt und sein Mann im Eiltempo durchs Königreich reist und seine Besichtigungen macht?
Wird dieser Mann auf seinen Reisen auch einmal nach Bristol kommen? Er sehnt sich danach, dem Mann persönlich zu begegnen, ihm die Hand zu schütteln, mit ihm am Kai entlangzuschlendern und ihm zu lauschen, wenn er von seinem Besuch auf der düsteren Nordseite der Insel oder von seinen Abenteuern beim Geschäft des Schreibens berichtet. Aber er fürchtet, dass es keine Begegnung geben wird, nicht in diesem Leben. Wenn er sich für ein Bild für sie beide – für seinen Mann und ihn – entscheiden muss, dann würde er schreiben, sie seien wie zwei Schiffe, die in entgegengesetzte Richtungen segeln, das eine nach Westen, das andere nach Osten. Oder besser, dass sie Hilfsmatrosen sind, die in der Takelage arbeiten, der eine auf einem nach Westen segelnden Schiff, der andere auf einem nach Osten segelnden Schiff. Ihre Schiffe fahren dicht aneinander vorbei, in Rufweite. Aber die See ist rauh, das Wetter stürmisch: Gischt peitscht ihnen in die Augen, ihre Hände brennen vom Tauwerk, so fahren sie aneinander vorbei und sind zu geschäftig, um auch nur zu winken.
(* Zitiert nach der Robinson-Crusoe-Ausgabe in Reclams Universalbibliothek. Aus dem Englischen von A. Tuhten, bearbeitet von Dr. Gerhard Jacob.)
Übersetzt von Reinhild Böhnke.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.