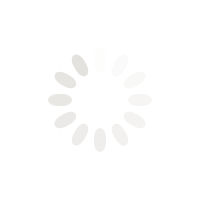Elfriede Jelinek – Nobelvorlesung
English
Swedish
French
German
Im Abseits
Ist Schreiben die Gabe der Schmiegsamkeit, der Anschmiegsamkeit an die Wirklichkeit? Man möchte sich ja gern anschmiegen, aber was geschieht da mit mir? Was geschieht mit denen, die die Wirklichkeit gar nicht wirklich kennen? Die ist ja sowas von zerzaust. Kein Kamm, der sie glätten könnte. Die Dichter fahren hindurch und versammeln ihre Haare verzweifelt zu einer Frisur, von der sie dann in den Nächten prompt heimgesucht werden. Etwas stimmt nicht mehr mit dem Aussehen. Aus seinem Heim der Träume kann das schön aufgetürmte Haar wieder verjagt werden, das sich aber ohnedies nicht mehr zähmen läßt. Oder wieder zusammengefallen ist und nun als Schleier vor einem Gesicht hängt, kaum daß es endlich gebändigt werden konnte. Oder unwillkürlich zu Berge steht vor Entsetzen vor dem, was dauernd geschieht. Es läßt sich einfach nicht ordnen. Es will nicht. So oft man auch mit dem Kamm mit den paar ausgebrochenen Zinken hindurchfährt – es will einfach nicht. Etwas stimmt jetzt noch weniger. Das Geschriebene, das vom Geschehen handelt, läuft einem unter der Hand davon wie die Zeit, und nicht nur die Zeit, während der es geschrieben wurde, während der nicht gelebt wurde. Niemand hat etwas versäumt, wenn nicht gelebt worden ist. Nicht der Lebende und nicht die getötete Zeit, und der Tote schon gar nicht. Die Zeit ist, als man noch geschrieben hat, in die Werke andrer Dichter eingedrungen. Da sie die Zeit ist, kann sie alles auf einmal: in die eigene Arbeit eindringen und gleichzeitig in die andrer, in die zerrauften Frisuren andrer fahren wie ein frischer, wenn auch böser Wind, der sich, von der Wirklichkeit her, plötzlich und unerwartet erhoben hat. Wenn einmal etwas aufgestanden ist, dann legt es sich vielleicht nicht so schnell wieder hin. Der Wutwind weht und reißt alles mit. Und es reißt alles davon, egal wohin, aber nie mehr in diese Wirklichkeit, die ja abgebildet werden soll, zurück. Überallhin, nur dorthin nicht. Die Wirklichkeit ist das, was unter die Haare, unter die Röcke fährt und sie eben: davonreißt, in etwas anderes hinein. Wie soll der Dichter die Wirklichkeit kennen, wenn sie es ist, die in ihn fährt und ihn davonreißt, immer ins Abseits. Von dort sieht er einerseits besser, andrerseits kann er selbst auf dem Weg der Wirklichkeit nicht bleiben. Er hat dort keinen Platz. Sein Platz ist immer außerhalb. Nur was er aus dem Außen hineinsagt, kann aufgenommen werden, und zwar weil er Zweideutigkeiten sagt. Und da sind auch schon zwei Passende, zwei Richtige, die mahnen, daß nichts passiert, zwei, die es in unterschiedliche Richtungen ausdeuten, ausgreifen bis auf den unzureichenden Grund, der längst herausgebrochen ist wie die Reißzähne des Kamms. Entweder oder. Wahr oder falsch. Das mußte ja früher oder später passieren, da der Boden als Baugrund doch höchst unzureichend war. Wie sollte man auf einem bodenlosen Loch auch bauen können? Aber das Unzureichende, das in ihr Blickfeld gerät, reicht den Dichtern trotzdem immer noch für etwas, das sie aber auch lassen könnten. Sie könnten es sein lassen, und sie lassen es auch sein. Sie bringen es nicht um. Sie schauen es nur an mit ihren unklaren Augen, aber es wird durch diesen unklaren Blick nicht beliebig. Der Blick trifft genau. Das von diesem Blick Getroffene sagt noch im Hinsinken, obwohl es ja kaum angeschaut wurde, obwohl es noch nicht einmal dem scharfen Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt worden ist, das Getroffene sagt niemals, daß es auch etwas andres hätte sein können, bevor es dieser einen Beschreibung zum Opfer gefallen ist. Es besagt genau das, was besser ungesagt geblieben wäre (weil man es hätte besser sagen können?), was immer unklar bleiben mußte und grundlos. Zuviele sind schon bis zum Bauch darin eingesunken. Es ist Treibsand, aber er treibt nichts an. Es ist grundlos, aber nicht ohne Grund. Es ist beliebig, aber es wird nicht geliebt.
Das Außerhalb dient dem Leben, das genau dort nicht stattfindet, sonst wären wir alle ja nicht mittendrinnen, im Vollen, im vollen Menschenleben, und es dient der Beobachtung des Lebens, das immer woanders stattfindet. Dort, wo man nicht ist. Warum jemanden beschimpfen, weil er auf den Weg des Reisens, des Lebens, des Lebensreisens nicht zurückfindet, wenn es ihn vertragen hat – und dieses Vertragen ist kein sich mit jemand anderem Vertragen, aber auch kein Weitertragen –, einfach zufällig vertragen hat wie den Staub an den Schuhen, der von der Hausfrau unerbittlich verfolgt wird, wenn auch etwas weniger unerbittlich als der Fremde von den Heimischen verfolgt wird. Was ist das für ein Staub? Ist er radioaktiv oder von allein aktiv, einfach so, ich frage ja nur, weil er diese seltsame Leuchtspur auf dem Weg hinterläßt? Ist das, was da nebenher läuft und nie mehr mit dem Schreibenden zusammenkommt, der Weg, oder ist der Schreibende derjenige, der danebenläuft, ins Abseits? Verschieden ist er noch nicht, aber im Abgeschiedenen ist er immerhin schon. Von dort sieht er diejenigen, die von ihm verschieden sind, voneinander aber auch, in ihrer Vielfalt an, um sie in Einfältigkeit darzustellen, um sie in Form zu bringen, denn die Form ist das Wichtigste, von dort aus also sieht er sie besser. Aber auch das wird ihm angekreidet, also sind das Kreidespuren und nicht Leuchtstoffpartikel, die den Weg des Schreibens markieren? In jedem Fall ist es ein Markieren, das gleichzeitig zeigt und wieder verschleiert und die Spur, die von ihm selbst gelegt wurde, danach sorgfältig wieder verwischt. Man ist gar nicht dagewesen. Aber man weiß trotzdem, was los ist. Es ist einem von einem Bildschirm herunter gesagt worden, aus vor Schmerz verzerrten, blutverschmierten Gesichtern, aus lachenden geschminkten, für die Schminke vorher noch eigens aufgeblasenen Mündern oder andren, die eine Frage im Quiz richtig beantwortet haben, oder geborenen Mundmenschen, Frauen, die nichts dafür- und nichts dazutun können, die aufgestanden sind und eine Jacke ausgezogen haben, um ihre frisch gehärteten Brüste, die früher gestählte waren und Männern gehört haben, in die Kamera zu halten. Dazu jede Menge Kehlen, aus denen es heraussingt wie Mundgeruch, nur lauter. Das ist das, was auf dem Weg gesehen werden könnte, befände man sich noch auf ihm. Man geht dem Weg aus dem Weg. Vielleicht sieht man ihn aus der Ferne, wo man alleinbleibt, und wie gern, denn den Weg will man sehen, aber nicht gehen. Hat dieser Pfad jetzt ein Geräusch von sich gegeben? Will er auch noch durch Geräusche, nicht nur durch Leuchten, schreiende Leute, schreiendes Leuchten auf sich aufmerksam machen? Hat der Weg, den man nicht gehen kann, Angst davor, gar nicht begangen zu werden, wo doch soviele Sünden begangen werden, andauernd, Folter, Verbrechen, Diebstahl, schwere Nötigung, nötige Schwere beim Herstellen von bedeutenden Weltschicksalen? Dem Weg ist es egal. Der trägt alles auf sich, in Festigkeit, wenn auch grundlos. Ohne Grund. Auf verlorenem Boden. Mir stehen, wie gesagt, die Haare zu Berge, und kein Festiger da, der sie wieder zum Niederlegen zwingen könnte. Auch keine Festigkeit in mir. Nicht auf mir, nicht in mir. Wenn man im Abseits ist, muß man immer bereit sein, noch ein Stück und noch ein Stück zur Seite zu springen, ins Nichts, das gleich neben dem Abseits liegt. Und das Abseits hat seine Abseitsfalle auch gleich mitgebracht, die ist jederzeit bereit, sie klafft auf, um einen noch weiter fortzulocken. Das Fortlocken ist ein Hereinlocken. Bitte, ich möchte jetzt den Weg nicht aus den Augen verlieren, auf dem ich nicht bin. Ich möchte ihn doch ordentlich und vor allem richtig und genau beschreiben. Wenn ich ihn schon anschaue, soll es auch etwas bringen. Aber dieser Weg erspart mir nichts. Er läßt mir nichts. Was bleibt mir also übrig? Auch das Unterwegs ist mir versperrt, ich kann mich ja kaum fortbewegen. Ich bin fort, indem ich nicht fortgehe. Und auch dort möchte ich zur Sicherheit Schutz haben vor meiner eigenen Unsicherheit, aber auch vor der Unsicherheit des Bodens, auf dem ich stehe. Es läuft zur Sicherheit, nicht nur um mich zu behüten, meine Sprache neben mir her und kontrolliert, ob ich es auch richtig mache, ob ich es auch richtig falsch mache, die Wirklichkeit zu beschreiben, denn sie muß immer falsch beschrieben werden, sie kann nicht anders, aber so falsch, daß jeder, der sie liest oder hört, ihre Falschheit sofort bemerkt. Die lügt ja! Und dieser Hund Sprache, der mich beschützen soll, dafür habe ich ihn ja, der schnappt jetzt nach mir. Mein Schutz will mich beißen. Mein einziger Schutz vor dem Beschriebenwerden, die Sprache, die, umgekehrt, zum Beschreiben von etwas anderem, das nicht ich bin, da ist – dafür beschreibe ich ja soviel Papier –, mein einziger Schutz kehrt sich also gegen mich. Vielleicht habe ich ihn überhaupt nur, damit er, indem er vorgibt, mich zu schützen, sich auf mich stürzt. Weil ich im Schreiben Schutz gesucht habe, kehrt sich dieses Unterwegssein, die Sprache, die in der Bewegung, im Sprechen, mir ein sicherer Unterstand zu sein schien, gegen mich. Kein Wunder. Ich habe ihr doch sofort mißtraut. Was ist das für eine Tarnung, die dazu da ist, daß man nicht unsichtbar wird, sondern immer deutlicher?
Die Sprache gerät ja irrtümlich manchmal auf den Weg, aber aus dem Weg geht sie nicht. Es ist kein willkürlicher Vorgang, das mit Sprache Sprechen, es ist einer, der unwillkürlich willkürlich ist, ob man will oder nicht. Die Sprache weiß, was sie will. Gut für sie, ich weiß es nämlich nicht, und ich weiß die Namen nicht. Das Gerede, das Reden überhaupt redet jetzt dort drüben weiter, denn es ist immer ein Weiterreden, ohne Anfang und Ende, aber es ist kein Sprechen. Es redet also dort drüben, wo sich immer die anderen aufhalten, weil sie sich nicht aufhalten wollen, sie sind sehr beschäftigt. Dort drüben nur sie. Ich nicht. Nur die Sprache, die sich manchmal von mir entfernt, zu den Leuten, nicht den anderen Leuten, sondern den wirklichen, echten, auf den gut beschilderten Weg (wer kann sich hier noch verirren?) hinüber entfernt, sie wie eine Kamera bei jeder Bewegung verfolgt, damit wenigstens sie, die Sprache, erfährt, wie und was das Leben ist, weil es genau das dann nicht ist, und das alles muß danach auch noch in dem, was es eben gerade nicht ist, beschrieben werden. Reden wir darüber, daß wir wieder einmal zur Vorsorgeuntersuchung gehen sollten. Doch auf einmal sprechen wir plötzlich, in aller Strenge, wie einer, der die Wahl hat, auch nicht zu sprechen. Was immer geschieht, nur die Sprache geht von mir weg, ich selbst, ich bleibe weg. Die Sprache geht. Ich bleibe, aber weg. Nicht auf dem Weg. Und mir bleibt die Sprache weg.
Nein, sie ist noch da. Ist sie etwa die ganze Zeit dagewesen, hat sie überlegt, wem sie überlegen sein könnte? Sie hat mich jetzt bemerkt und sofort angeherrscht, diese Sprache. Diese Herrenanmaßung wagt sie gegen mich, sie erhebt die Hand gegen mich, sie mag mich nicht. Sie würde gern die netten Leute auf dem Weg mögen, neben denen sie herrennt wie der Hund, der sie ist, der Gehorsam vortäuscht. In Wirklichkeit ist sie nicht nur mir, sie ist auch allen anderen ungehorsam. Sie ist für sich. Sie schreit durch die Nacht, denn man hat vergessen, neben diesem Weg Lichter anzubringen, die von nichts als Sonne gespeist werden und gar keinen Strom aus der Dose mehr brauchen, und dem Pfad einen anständigen Pfadnamen zu geben. Er hat jedoch soviele Namen, daß man mit dem Benennen nicht nachkommen würde, versuchte man es. Ich schreie hinüber, in meiner Abgeschiedenheit, über diese Gräber der Verschiedenen stapfend, denn da ich schon nebenher renne, kann ich nicht auch noch drauf achten, worauf ich trete, wen ich zertrete, ich möchte nur irgendwie dorthin, wo meine Sprache schon ist und höhnisch zu mir herübergrinst. Sie weiß ja, daß, wenn ich einmal zu leben versuchte, sie mir das schon rechtzeitig eintränken würde. Sie würde es mir zuerst eintränken, dann auch noch versalzen. Gut. Streue ich also noch Salz auf den Weg der andren, ich werfe ihn hinüber, daß ihr Eis schmilzt, Streusalz, damit der Sprache ihr sicherer Grund genommen werde. Dabei ist sie doch längst bodenlos. Eine bodenlose Frechheit von ihr! Wenn ich mich schon nicht auf sicherem Grund befinde, soll meine Sprache das auch nicht dürfen. Recht geschieht ihr! Warum ist sie nicht bei mir geblieben, im Abseits, warum hat sie sich von mir getrennt? Sie wollte mehr sehen als ich? Auf dem Hauptweg dort drüben, wo mehr Leute sind, vor allem angenehmere, die miteinander nett plaudern? Sie wollte mehr wissen als ich? Sie hat zwar je schon mehr gewußt als ich, aber es muß immer noch mehr sein. Sie wird sich durch in sich Hineinfressen noch umbringen, meine Sprache. Sie wird sich überfressen an der Wirklichkeit. Geschieht ihr recht! Ich habe sie ausgespuckt, aber sie selber spuckt nichts aus, sie ist eine gute Futterverwerterin. Meine Sprache ruft zu mir herüber, ins Abseits, sie ruft am liebsten ins Abseits, da muß sie nicht so genau zielen, das muß sie auch nicht, denn sie trifft ihr Ziel ja, indem sie nicht irgend etwas sagt, sondern mit der „Strenge des Lassenden“ spricht, wie Heidegger über Trakl sagt. Sie ruft mich an, die Sprache, das kann heute jeder, denn er hat seine Sprache in einem kleinen Gerät immer bei sich, damit er sprechen kann, wozu hätte er es denn gelernt?, sie ruft mich also dort, wo ich in der Falle stecke und schreie und strample, aber nein, es stimmt nicht, nicht meine Sprache ruft, die ist ja ebenfalls weg, meine Sprache ist mir weggeblieben, sie muß daher anrufen, sie schreit mir ins Ohr, egal aus welchem Gerät, einem Speicher oder einem Handy, einem Zellentelefon, von dort brüllt sie mir ins Ohr, daß es keinen Sinn hat, etwas auszusprechen, das tut sie schon selber, ich soll einfach sagen, was sie mir vorsagt; denn noch weniger Sinn hätte es, sich einmal auszusprechen mit einem lieben Menschen, der der Fall ist und dem man vertrauen kann, weil er gefallen ist und nicht so schnell wieder aufstehen kann, um einen zu verfolgen und ein wenig, ja, zu plaudern. Es hat keinen Sinn. Das Sagen meiner Sprache dort drüben auf dem angenehmen Weg (ich weiß, der ist angenehmer als meiner, der ja eigentlich gar kein Weg ist, aber sehen kann ich es nicht genau, ich weiß aber, daß ich dort auch gern wäre), das Sagen meiner Sprache also ist, indem es sich von mir getrennt hat, sofort ein Aussprechen geworden. Nein, keine Aussprache mit jemandem. Ein Aussprechen. Sie hört sich beim Aussprechen selbst zu, meine Sprache, sie korrigiert sich selbst, weil die Aussprache jederzeit und immer noch verbessert werden kann; ja, immer kann sie verbessert werden, sie ist sogar ausschließlich dazu da, verbessert zu werden und dann eine neue Sprachregelung zu treffen, aber auch die nur, um die Regeln sofort wieder umstoßen zu können. Das wird dann die neue Überbrückung zu einer Erlösung, ich meine natürlich Lösung. Eine Eselsbrücke. Bitte, liebe Sprache, willst du nicht zuvor wenigstens ein einziges Mal zuhören? Damit du etwas lernst, damit du die Ausspracheregeln endlich lernst … Was schreist und räsonierst du dort drüben? Tust du das, Sprache, damit ich dich wieder in Gnaden bei mir aufnehme? Ich dachte, du wolltest gar nicht mehr zu mir zurück! Du hast mit keinem einzigen Zeichen zu verstehen gegeben, daß du zu mir zurückwolltest, es wäre auch sinnlos gewesen, ich hätte das Zeichen nicht verstanden. Du wärst Sprache erst geworden, um von mir fortzukommen und mir damit mein Fortkommen zu sichern? Aber da wird nichts gesichert. Und von dir schon gar nicht, so wie ich dich kenne. Ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Du willst freiwillig zu mir zurück? Ich nehme dich nicht mehr auf, was sagst du nun? Weg ist weg. Weg ist kein Weg. Also wenn meine Abgeschiedenheit, wenn mein ständiges Fehlen, mein ununterbrochenes Abseitssein persönlich kämen, um die Sprache zurückzuholen, damit sie, bei mir gut untergebracht, endlich daheim, zu einem schönen Laut käme, den sie ausstoßen könnte, so geschähe das ja nur, damit sie mich durch diesen Laut, dieses durchdringende, gellende Jaulen einer Sirene, in die die Luft hineinfährt, noch mehr, immer noch mehr ins Abseits hineintriebe. Durch den Rückstoß dieser Sprache, die ich selbst erzeugt habe und die mir davongerannt ist (oder habe ich sie zu diesem Zweck erzeugt? Damit sie sofort vor mir davonläuft, weil ich selbst es nicht geschafft habe, rechtzeitig vor mir selbst davonzurennen?), werde ich immer weiter in diesen abseitigen Raum hineingejagt. Meine Sprache wälzt sich bereits wohlig in ihrer Suhle, dem kleinen provisorischen Grab auf dem Weg, und sie schaut hinauf zum Grab in den Lüften, sie wälzt sich auf den Rücken, ein zutrauliches Tier, das den Menschen gefallen möchte wie jede anständige Sprache, sie wälzt sich, macht die Beine breit, wahrscheinlich um sich streicheln zu lassen, warum denn sonst. Sie ist ja süchtig nach Liebkosungen. Das hält sie davon ab, den Toten nachzuschauen, auf die ich dafür schauen muß, das bleibt dann natürlich an mir hängen. Daher hatte ich ja keine Zeit, meine Sprache im Zaum zu halten, die sich jetzt schamlos unter den Händen der Streichler wälzt. Es gibt einfach zuviele Tote, auf die ich schauen muß, das ist ein österreichischer Fachausdruck für: um die ich mich kümmern, die ich gut behandeln muß, aber dafür sind wir ja berühmt, daß wir alle immer gut behandeln. Die Welt schaut schon auf uns, nur keine Sorge. Das müssen wir nicht selber besorgen. Doch je deutlicher diese Aufforderung zum auf sie, die Toten, Schauen in mir ertönt, umso weniger kann ich auf meine Worte achten. Ich muß auf die Toten schauen, derweil die Spaziergänger die liebe gute Sprache streicheln und kraulen, was die Toten nicht lebendiger macht. Niemand hat schuld. Auch ich, zerzaust wie ich und mein Haar sind, habe keine schuld, daß die Toten tot bleiben. Ich will, daß die Sprache dort drüben endlich aufhört, sich zur Sklavin fremder Hände zu machen, auch wenn sie ihr noch so wohltun, ich will, daß sie anfangen soll, keine Forderungen zu stellen, sondern selbst eine Forderung zu werden, sich endlich zu stellen, nicht dem Liebkosen, sondern einer Forderung, zu mir zurückzukommen, denn stellen muß die Sprache sich immer, sie weiß es allerdings oft nicht und hört mir nicht zu. Sie muß sich stellen, denn die Menschen, die sie annehmen wollen, an Kindes statt, sie ist ja so lieb, wenn man sie umgekehrt auch liebhat, die Menschen also stellen sich nie, sie bestimmen, aber sie stellen sich nicht, viele von ihnen haben sogar ihren Gestellungsbefehl zur Geselligkeit sofort vernichtet, zerrissen, verbrannt, die Fahne gleich mit, so. Je mehr Leute also die Aufforderung meiner Sprache annehmen, sie am Bauch zu kratzen, etwas zu zausen, ihre Zutraulichkeit liebevoll anzunehmen, desto weiter stolpere ich davon, ich habe meine Sprache endgültig an die verloren, die sie besser behandeln, ich fliege schon fast, wo war doch gleich dieser Weg, den ich zum Nacheilen brauche? Wie komme ich wozu wohin? Wie komme ich an den Ort, wo ich mein Werkzeug auspacken, in Wirklichkeit aber gleich einpacken kann? Dort drüben schimmert etwas hell unter den Zweigen, ist das der Ort, wo meine Sprache den anderen zuerst schmeichelt, sie in Sicherheit wiegt, nur um selbst endlich einmal liebevoll gewiegt zu werden? Oder will sie gar schon wieder zubeißen? Die will immer nur beißen, bloß wissen die andren das noch nicht, ich aber kenne sie gut, sie war ja lange bei mir. Zuvor wird erst mal gezärtelt und geturtelt mit diesem scheinbar zahmen Tier, das sie ohnehin alle selber zu Hause haben, warum sollten sie sich also ein fremdes ins Haus holen? Warum also sollte diese Sprache anders sein als das, was sie schon kennen? Und wäre sie anders, dann wird es vielleicht nicht ungefährlich sein, sie zu sich zu nehmen. Vielleicht verträgt sie sich nicht mit der, die sie schon haben. Je mehr freundliche fremde Menschen, die zu leben verstehen, ihr Leben deswegen aber noch lange nicht verstehen, da ihre Streichelabsichten verfolgen, denn verfolgen müssen sie immer was, desto mehr durchschaut mein Schauen den Weg zur Sprache zurück nicht mehr. Miles and more. Wer sollte etwas durchschauen, wenn nicht das Schauen? Das Sprechen will das Schauen auch noch übernehmen? Es will sprechen, bevor es noch geschaut hat? Es wälzt sich da, wird von Händen angetappt, wird von Winden angetost, wird von Stürmen verzärtelt, vom Hören beleidigt, bis es gar nicht mehr hinhört. Na ja, dann: alles mal herhören! Wer nicht hören will, muß sprechen, ohne gehört zu werden. Fast alle werden nicht gehört, obwohl sie sprechen. Ich werde gehört, obwohl mir meine Sprache nicht gehört, obwohl ich sie kaum noch sehen kann. Man sagt ihr vieles nach. So muß sie selber nicht mehr viel sagen, auch gut. Man hört ihr nach, wie sie langsam nachspricht, während irgendwo ein roter Knopf gedrückt wird, der eine schreckliche Explosion auslöst. Es bleibt nur noch übrig zu sagen: Vater unser, der du bist. Sie kann nicht mich damit meinen, obwohl ich schließlich meiner Sprache Vater, also: Mutter bin. Ich bin der Vater meiner Muttersprache. Die Muttersprache war von Anfang an schon da, sie war in mir, aber kein Vater war da, der dazugehörig gewesen wäre. Meine Sprache war oft ungehörig, das wurde mir deutlich zu verstehen gegeben, aber ich wollte es nicht verstehen. Meine Schuld. Der Vater hat mitsamt der Muttersprache diese Kleinfamilie verlassen. Recht hatte er. Ich wäre an seiner Stelle auch nicht geblieben. Meine Muttersprache ist jetzt dem Vater nachgegangen, sie ist fort. Sie ist, wie gesagt, dort drüben. Sie hört den Leuten auf dem Weg zu. Auf dem Weg des Vaters, der zu früh gegangen ist. Jetzt weiß sie etwas, was du nicht weißt, was er nicht gewußt hat. Aber je mehr sie weiß, umso nichtssagender wird sie. Sie sagt natürlich dauernd etwas, aber sie ist nichtssagend. Und schon nimmt die Abgeschiedenheit ihren Abschied. Sie wird nicht gebraucht. Keiner sieht, daß ich ja noch drinnen bin, in der Abgeschiedenheit. Man achtet meiner nicht. Man achtet mich vielleicht schon, aber meiner achtet man nicht. Wie erreiche ich, daß all diese Worte von mir etwas sagen, das uns etwas sagen könnte? Nicht, indem ich spreche. Ich kann ja gar nicht sprechen, meine Sprache ist derzeit nämlich leider nicht zu Hause. Dort drüben sagt sie was andres, das ich ihr auch nicht aufgetragen habe, aber meinen Befehl an sie hat sie von Beginn an schon vergessen. Mir sagt sie es nicht, obwohl sie doch mir gehört. Mir sagt meine Sprache nichts, wie soll sie dann anderen etwas sagen? Sie ist aber auch nicht nichtssagend, das müssen Sie zugeben! Sie sagt umso mehr, je ferner sie mir ist, ja, erst dann traut sie sich, etwas zu sagen, das sie selber sagen will, dann traut sie sich, mir nicht zu gehorchen, sich mir zu widersetzen. Wenn man schaut, entfernt man sich von seinem Gegenstand, je länger man ihn ansieht. Wenn man spricht, fängt man ihn wieder ein, aber man kann ihn nicht behalten. Er reißt sich los und eilt der eigenen Benennung hinterher, den vielen Worten, die ich gemacht und die ich verloren habe. Der Worte sind genug gewechselt, der Wechselkurs ist unheimlich schlecht, und dann ist er nur noch: unheimlich. Ich sage etwas, und dann ist es von Anfang an schon vergessen gewesen. Das hat es angestrebt, es wollte ja fort von mir. Das Unsagbare wird jeden Tag gesagt, aber das, was ich sage, das soll nicht gesagt werden dürfen. Das ist gemein von dem Gesagten. Das ist sagenhaft gemein. Nicht einmal zu mir gehören will das Gesagte. Es will getan werden, damit man sagen kann: gesagt – getan. Ich würde mich ja zufriedengeben, wenn sie verleugnete, mir zu gehören, meine Sprache, aber zu mir gehören sollte sie schon. Wie kann ich erreichen, daß sie wenigstens ein bißchen an mir hängt? An den andren bleibt ja nichts hängen, also biete ich mich ihr an. Komm zurück! Kommen Sie zurück, bitte! Aber nein. Sie hört dort drüben auf dem Pfad Geheimnisse, die ich nicht wissen soll, meine Sprache, und sie sagt sie weiter, diese Geheimnisse, andren, die sie nicht hören wollen. Ich würde schon wollen, es stünde mir auch zu, ja, auch gut zu Gesicht, meinetwegen, aber sie bleibt nicht stehen, und sprechen zu mir, das tut sie auch nicht. Sie ist im Leeren, das sich gerade dadurch auszeichnet und von mir unterscheidet, daß sich sehr viele dort befinden. Das Leere ist der Weg. Ich bin sogar abseits der Leere. Ich habe den Weg verlassen. Ich habe immer nur nachgesagt. Man hat mir vieles nachgesagt, aber das stimmt fast alles nicht. Ich habe selber nur nachgesagt, und ich behaupte: das ist jetzt das eigentliche Sagen. Wie gesagt – einfach sagenhaft! Soviel gesagt ist schon lange nicht worden. Man kommt mit dem Zuhören gar nicht mehr nach, obwohl man zuhören muß, um etwas zu können. In dieser Hinsicht, die in Wirklichkeit ein Wegschauen ist, auch ein Wegschauen von mir selbst, kann man mir aber nichts nachsagen, da gibts nichts, das gibt nichts her. Ich schaue dem Leben immer nur nach, meine Sprache zeigt mir den Rücken, damit sie fremden Leuten den Bauch zum Liebhaben hinhalten kann, schamlos, mir zeigt sie den Rücken, wenn überhaupt irgend etwas. Zu oft gibt sie mir kein Zeichen und sagt auch nichts. Manchmal sehe ich sie dort drüben gar nicht mehr, und jetzt kann ich nicht einmal sagen „wie gesagt“, denn ich habe es zwar schon öfter gesagt, aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen, mir fehlen die Worte. Manchmal sehe ich ihren Rücken oder die Unterseite ihrer Füße, mit denen sie nicht richtig gehen können, die Worte, aber schneller als ich schon lange und immer noch. Was mache ich da? Hat sie sich darum in einigem Abstand von mir hingelegt, die liebe Sprache? So wird sie natürlich immer schneller sein als ich, aufspringen und wegrennen, wenn ich von meiner Abseitsstelle zu ihr hinübergehe, um sie zu holen. Ich weiß es nicht, warum ich sie holen sollte. Damit sie nicht mich holt? Vielleicht weiß sie es, die mir davongelaufen ist? Die mir nicht folgt? Die nun dem Schauen und Sagen der andren folgt, und die kann sie nun wirklich nicht mit mir verwechseln. Die sind anders, weil sie die anderen sind. Aus keinem anderen Grund, als daß sie die anderen sind. Das genügt meinem Sprechen schon. Hauptsache, ich tue es nicht: sprechen. Die anderen, immer die anderen, damit ich es nicht bin, der sie gehört, die süße Sprache. Ich würde sie ja auch so gern streicheln, wie die anderen drüben, wenn ich sie nur erwischen könnte. Aber sie ist ja dort drüben, damit ich sie nicht erwischen kann.
Wann wird sie sich still davonmachen? Wann wird sich etwas davonmachen, damit Stille ist? Je mehr die Sprache sich dort drüben davonmacht, umso lauter hört man sie. Sie ist in aller Munde, nur in meinem Mund ist sie nicht. Ich bin umnachtet. Ich bin nicht ohnmächtig, aber ich bin umnachtet. Ich bin übernächtigt davon, meiner Sprache nachzuschauen wie ein Leuchtturm aufs Meer, der jemandem heimleuchten soll und daher selber erhellt worden ist, der im sich Drehen immer etwas anderes aus dem Dunkel herausschält, das aber ohnehin da ist, ob man es nun erhellt oder nicht, es ist ein Leuchtturm, der keinem hilft, auch wenn derjenige sich das noch so sehr wünscht, um nicht im Wasser sterben zu müssen. Je genauer ich sie auszumachen versuche, umso eigensinniger erlischt sie nicht, die Sprache. Ich mache diese Sprachflamme jetzt mechanisch aus, ich schalte auf Sparflamme, aber je mehr ich mich über sie zu stülpen versuche, ein Ersticker an einem langen Stab, mit dem in meiner Kindheit die Kerzen in der Kirche ausgelöscht wurden, je mehr ich diese Flamme zu ersticken suche, umso mehr Luft scheint sie zu haben. Umso lauter schreit sie, sich wälzend unter Tausenden von Händen, die ihr guttun, was ich leider nie getan habe, ich weiß ja selber nicht, was mir guttun würde, also sie schreit jetzt, damit sie von mir fortbleiben kann. Sie schreit die andren an, damit die in ihr Horn stoßen und schreien wie sie, damit es lauter wird. Sie schreit, daß ich ihr nicht zu nahe kommen soll. Es soll überhaupt keiner einem andren zu nahe kommen. Und das Gesagte soll dem, was man sagen will, auch nicht zu nahe kommen. Man soll der eigenen Sprache nicht zu nahetreten, das ist ein Affront, sie ist glatt imstande, sich selbst etwas nachzusprechen, gellend laut, damit man nicht hört, daß ihr das, was sie sagt, vorher vorgesprochen wurde. Sie macht mir sogar Versprechungen, damit ich wegbleibe von ihr. Sie verspricht mir alles, wenn ich ihr nur nicht nahekomme. Millionen dürfen ihr nahekommen, nur ich nicht! Dabei ist sie meine! Wie finden Sie das? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich das finde. Diese Sprache hat ihren Anfang wohl vergessen, anders kann ich es mir nicht erklären. Sie hat einst bei mir klein angefangen. Nein, wie die groß geworden ist, gar nicht zum Sagen! So erkenne ich sie ja gar nicht. Ich habe sie noch gekannt, als sie soo klein gewesen ist. Als es so still gewesen ist, als die Sprache noch mein Kind war. Jetzt ist sie auf einmal riesig geworden. Das ist nicht mehr mein Kind. Das Kind ist nicht erwachsen geworden, dafür aber groß, es weiß nicht, daß es mir noch nicht entwachsen ist, aber wach ist es immerhin. Es ist so wach, daß es sich selbst mit seinem Schreien übertönt, und auch jeden anderen, der lauter schreit als sie. Dann schraubt sie sich in unglaubliche Höhen. Glauben Sie mir, das wollen Sie gar nicht wirklich hören! Ich bin nicht stolz auf dieses Kind, glauben Sie mir auch das, bitte! Ich habe an seinem Anfang gewollt, daß es so leise bleibt wie damals, als es noch sprachlos war. Ich will auch jetzt nicht, daß es über etwas hinwegfegt wie ein Sturm, daß es andre dazu bringt, noch lauter zu brüllen und die Arme hochzureißen und mit harten Gegenständen zu werfen, die meine Sprache gar nicht mehr fassen und fangen kann, sie ist ja, auch meine Schuld, immer so unsportlich gewesen. Sie fängt nicht. Sie wirft zwar, aber fangen kann sie nicht. Ich bleibe in ihr gefangen, auch wenn sie weg ist. Ich bin die Gefangene meiner Sprache, die mein Gefängniswärter ist. Komisch – sie paßt ja gar nicht auf mich auf! Weil sie meiner so sicher ist? Weil sie so sicher ist, daß ich nicht wegrenne, glaubt sie deshalb, sie kann selber von mir fort? Da kommt einer, der schon gestorben ist, und der spricht zu mir, obwohl das für ihn nicht vorgesehen ist. Er darf das, viele Tote sprechen jetzt mit ihren erstickten Stimmen, jetzt trauen sie sich das, weil meine eigene Sprache nicht auf mich aufpaßt. Weil sie weiß, daß das nicht nötig ist. Wenn sie mir auch wegrennen mag, ich komme ihr nicht abhanden. Ich bin ihr zu Handen, aber dafür ist sie mir abhanden gekommen. Ich aber bleibe. Was aber bleibt, stiften nicht die Dichter. Was bleibt, ist fort. Der Höhenflug wurde gestrichen. Es ist nichts und niemand eingetroffen. Und wenn doch, wider jede Vernunft, etwas, das gar nicht angekommen ist, doch ein wenig bleiben möchte, dann ist dafür das, was bleibt, das Flüchtigste, die Sprache, verschwunden. Sie hat auf ein neues Stellenangebot geantwortet. Was bleiben soll, ist immer fort. Es ist jedenfalls nicht da. Was bleibt einem also übrig.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.