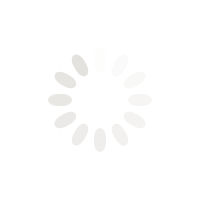Doris Lessing – Nobelvorlesung
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
7. Dezember 2007
Den Nobelpreis nicht gewinnen
Ich stehe in einem Türrahmen und blicke durch wehende Staubwolken dorthin, wo es noch Wald gibt, der nicht abgeholzt worden ist, wie ich höre. Gestern bin ich meilenweit an Baumstümpfen und verkohlten Flächen vorbeigefahren, wo ’56 der wunderbarste Wald stand, den ich je gesehen habe; jetzt ist er vernichtet. Menschen müssen essen. Sie brauchen Brennstoff.
Es ist Anfang der achtziger Jahre, und ich bin im Nordwesten Simbabwes zu Besuch bei einem Freund, der an einer Schule in London Lehrer war. Er ist hier, „um Afrika zu helfen“, wie wir sagen. Er ist eine gute idealistische Seele, und als er diese Schule hier sah, verfiel er vor Schreck in eine Depression, von der er sich nur schwer erholte. Die Schule ist wie alle anderen, die nach der Unabhängigkeit gebaut worden sind. Sie besteht aus vier großen Räumen mit Ziegelwänden, die einfach nebeneinander in den Staub gesetzt worden sind, eins, zwei, drei, vier, mit einem kleineren Raum am Ende, das ist die Bibliothek. In den Klassenzimmern gibt es Tafeln, aber die Kreide hat mein Freund in der Hosentasche, damit sie nicht gestohlen wird. Es gibt in der Schule keinen Atlas und keinen Globus, keine Schulbücher oder Hefte oder Kugelschreiber. In der Bibliothek stehen nicht die Bücher, die die Schüler gerne lesen würden, nur dicke Wälzer aus amerikanischen Universitäten, die man kaum hochheben kann, Aussortiertes aus den Bibliotheken der Weißen, oder Bücher mit Titeln wie „Ein Wochenende in Paris“ oder „Felicity findet die Liebe“.
Eine Ziege sucht im dürren Gras nach Nahrung. Der Rektor hat Gelder der Schule veruntreut und ist suspendiert worden, was eine Frage aufwirft, die uns allen geläufig ist, wenn auch gewöhnlich in erhabeneren Zusammenhängen: Warum verhalten sich diese Leute so, obwohl sie doch wissen müssten, dass alles auf sie blickt?
Mein Freund hat kein Geld, denn alle, Schüler und Lehrer, leihen sich etwas bei ihm, wenn er sein Gehalt bekommen hat, und werden es wahrscheinlich nie zurückzahlen. Die Schüler sind zwischen sechs und sechsundzwanzig Jahre alt, denn manche konnten als Kinder nicht zur Schule gehen und holen das jetzt nach. Manche gehen jeden Morgen viele Meilen zu Fuß, bei jedem Wetter und über jeden Fluss. Sie können keine Hausaufgaben machen, denn in den Dörfern gibt es keinen Strom, und im Licht eines brennenden Holzscheits lernt es sich nicht besonders gut. Die Mädchen müssen Wasser holen und kochen, bevor sie zur Schule gehen und wenn sie aus der Schule kommen.
Wenn ich mit meinem Freund in seinem Zimmer sitze, kommen Leute schüchtern herein, und alle bitten sie um Bücher. „Bitte schicken Sie uns Bücher, wenn Sie wieder in London sind“, sagt ein Mann. „Lesen haben wir gelernt, aber Bücher haben wir nicht.“ Jeder, dem ich begegnet bin – alle haben sie um Bücher gebeten.
Ich war ein paar Tage dort. Der Staub wehte. Die Pumpen funktionierten nicht mehr, und die Frauen mussten das Wasser wieder am Fluss holen. Ein anderer idealistischer Lehrer aus England wurde regelrecht krank, als er sah, wie diese „Schule“ beschaffen war.
An meinem letzten Tag wurde die Ziege geschlachtet. Sie wurde in Stücke zerteilt und in einem großen Kanister gekocht. Das war das Festessen zum Halbjahrsende, auf das sich alle so gefreut hatten, gekochte Ziege mit Porridge. Es dauerte noch an, als ich abfuhr, zurück durch den verkohlten, abgeholzten Wald.
Ich glaube nicht, dass viele Schüler dieser Schule Preise bekommen werden.
Am nächsten Tag soll ich einen Vortrag in einer Schule im Norden Londons halten, in einer sehr guten Schule, deren Name allgemein bekannt ist. Es ist eine Jungenschule, mit schönen Gebäuden und Gartenanlagen.
Diese Kinder hier bekommen jede Woche Besuch von einer bekannten Persönlichkeit, und es liegt in der Natur der Sache, dass es sich dabei manchmal um die Väter, um Verwandte oder sogar um die Mütter der Schüler handelt. Besuch von einer Berühmtheit ist ganz normal für sie.
Während ich zu ihnen spreche, bin ich in Gedanken bei der staubumwehten Schule in Nordwest-Simbabwe, und ich blicke in die dezent erwartungsvollen englischen Gesichter vor mir und versuche, von dem zu erzählen, was ich in der Woche zuvor gesehen habe. Klassenzimmer, in denen es keine Bücher gibt, keine Schulbücher, keinen Atlas, nicht einmal eine Landkarte an der Wand. Eine Schule, in der die Lehrer darum bitten, dass man ihnen Bücher schickt, aus denen sie lernen können, wie man unterrichtet; sie sind selbst erst achtzehn, neunzehn. Ich erkläre diesen englischen Jungen, dass alle um Bücher bitten: „Bitte schicken Sie uns Bücher.“ Ganz bestimmt kennt jeder, der einmal eine Rede gehalten hat, diesen Moment, wenn man in ausdruckslose Gesichter blickt. Die Zuhörer können nicht hören, was man sagt: Sie haben keine Vorstellung im Kopf, die dem entspricht, was man gerade erzählt – in diesem Fall die Vorstellung von einer Schule, die inmitten von Staubwolken steht, wo das Wasser knapp ist und wo man sich zum Halbjahrsende eine frisch geschlachtete, in einem großen Topf gekochte Ziege gönnt.
Ist es für diese privilegierten Schüler denn gar nicht möglich, sich diese nackte Armut vorzustellen?
Ich tue, was ich kann. Sie sind höflich.
Ich bin sicher, dass einige von ihnen eines Tages Preise gewinnen werden.
Dann ist der Vortrag zu Ende. Im Anschluss frage ich die Lehrer, wie die Bibliothek ist und ob die Schüler lesen. In dieser privilegierten Schule höre ich, was ich immer höre, wenn ich Schulen oder selbst Universitäten besuche.
„Sie wissen ja, wie das ist“, sagte einer der Lehrer. „Viele Jungen haben noch nie gern gelesen, und die Bibliothek wird bei Weitem nicht ausgenutzt.“
Ja, wir wissen in der Tat, wie das ist. Wir alle.
Wir leben in einer zersplitternden Kultur, in der selbst das infrage gestellt ist, was vor ein paar Jahrzehnten noch Gewissheit war, und in der es ganz normal ist, dass junge Männer und Frauen nach jahrelanger Ausbildung nichts über die Welt wissen, nichts gelesen haben und sich nur in irgendeinem Fachgebiet auskennen, zum Beispiel mit Computern.
Wir haben es da mit einer unglaublichen Erfindung zu tun – Computer und das Internet und das Fernsehen. Das ist eine Revolution. Es ist nicht die erste Revolution, mit der die Menschheit fertig geworden ist. Die Revolution des Buchdrucks, die sich nicht innerhalb einiger Jahrzehnte vollzog, sondern viel länger gedauert hat, hat unseren Geist und unsere Denkweisen verwandelt. Tollkühn wie wir sind, haben wir das alles wie immer hingenommen und nie die Frage gestellt: Was wird mit uns passieren, jetzt, wo der Buchdruck erfunden ist? Und ebenso wenig sind wir darauf gekommen, uns zu fragen: Wie wird sich unser Leben, wie wird sich unsere Denkweise verändern durch dieses Internet, das eine ganze Generation mit seinen Belanglosigkeiten verführt hat, sodass selbst einigermaßen vernünftige Leute zugeben, dass man sich nur schwer losreißen kann, wenn man einmal süchtig ist, und es sein kann, dass auf einmal ein ganzer Tag mit Bloggen und so weiter vergangen ist.
Noch vor Kurzem hätte jeder einigermaßen gebildete Mensch das Lernen geachtet, die Bildung, und unsere große reiche Literatur. Es ist natürlich allgemein bekannt, dass die Leute in jenen glücklichen Zeiten manchmal auch so taten, als würden sie lesen, dass sie so taten, als hätten sie Achtung vor dem Lernen. Aber es ist verbürgt, dass sich Arbeiter und Arbeiterinnen nach Büchern sehnten, das beweisen die Bibliotheken, die Hochschulen und Akademien der Arbeiter im 18. und 19. Jahrhundert.
Das Lesen, die Bücher gehörten zur Allgemeinbildung.
Wenn ältere Leute mit jüngeren reden, dann begreifen sie, wie sehr Lesen bildet, weil die jungen Leute so viel weniger wissen. Und wenn Kinder nicht lesen können, liegt es daran, dass sie nichts gelesen haben.
Aber wir alle kennen diese traurige Geschichte.
Nur ihr Ende kennen wir nicht.
Wir denken an das alte Sprichwort: „Reading maketh a full man“, das Lesen erst sättigt einen Mann voll und ganz ─ und wenn man die entsprechenden Scherze zum Thema Völlerei einmal beiseite lässt ─ Lesen erfüllt Männer und Frauen mit Informationen, mit Geschichte, mit Wissen aus allen Gebieten.
Aber wir im Westen sind nicht die einzigen Menschen auf der Welt. Vor Kurzem erzählte mir eine Freundin, die in Simbabwe gewesen war, von einem Dorf, wo die Leute schon seit drei Tagen nichts mehr gegessen hatten, und trotzdem von Büchern und ihrer Beschaffung sprachen, von Bildung.
Ich gehöre einer kleinen Organisation an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bücher in die Dörfer zu schaffen. Es gab da einige Leute, die Simbabwe in anderem Zusammenhang an der Basis bereist hatten. Sie haben mir erzählt, dass es in den Dörfern entgegen anderslautenden Berichten lauter intelligente Leute gebe, Lehrer im Ruhestand, beurlaubte Lehrer, Kinder in den Ferien, alte Leute. Ich selbst habe eine kleine Studie darüber finanziert, was die Leute in Simbabwe gerne lesen wollten, und festgestellt, dass sich die Ergebnisse mit denen einer schwedischen Studie deckten, von der ich nichts gewusst hatte. Die Leute wollen dieselben Bücher lesen, die die Leute in Europa lesen wollen – Romane jeder Art, Science-Fiction, Lyrik, Kriminalromane, Theaterstücke, und Ratgeber, zum Beispiel zum Thema „Wie eröffne ich ein Bankkonto“. Und alles von Shakespeare. Wenn man Bücher für die Leute in den Dörfern sucht, hat man das Problem, dass sie nicht wissen, was es alles gibt, und so kommt es, dass ein Standardbuch wie zum Beispiel Der Bürgermeister von Casterbridge nur deshalb besonders beliebt ist, weil es zufällig da ist. Die Farm der Tiere ist aus naheliegenden Gründen der allerbeliebteste Roman.
Unsere Organisation wurde von Anfang an von Norwegen und dann von Schweden unterstützt. Ohne diese Unterstützung wären unsere Bücherlieferungen irgendwann ausgeblieben. Wir schafften aus allen möglichen Quellen Bücher heran. Man muss bedenken, dass ein vernünftiges Taschenbuch aus England in Simbabwe einen Monatslohn kostete – vor Mugabes Terrorregime. Inzwischen würde es wegen der Inflation mehrere Jahreslöhne kosten. Aber wenn man eine Kiste mit Büchern einmal in ein Dorf geschafft hat – wobei man bedenken muss, dass Benzin furchtbar knapp ist –, dann wird diese Kiste auf jeden Fall unter Tränen begrüßt. Es kann sein, dass die Bibliothek ein Brett ist, das unter einem Baum auf Ziegelsteinen liegt. Und innerhalb einer Woche wird es Lesekurse geben – wer lesen kann, bringt es denen bei, die es nicht können, ehrenamtlich –, und in einem abgelegenen Dorf haben sich ein paar junge Leute hingesetzt und Romane auf Tonga geschrieben, weil es keine Romane auf Tonga gab. Es gibt in Simbabwe ungefähr sechs Hauptsprachen, und in all diesen Sprachen gibt es Romane, in denen Gewalt und Inzest und lauter Verbrechen und Morde vorkommen.
Es heißt, dass ein Volk die Regierung bekommt, die es verdient, aber ich glaube, für Simbabwe trifft das nicht zu. Und wir müssen bedenken, dass diese Achtung vor Büchern und der Hunger nach ihnen nicht dem Mugabe-Regime entstammt, sondern dem davor, dem der Weißen. Er ist ein erstaunliches Phänomen, dieser Hunger nach Büchern, und er lässt sich von Kenia bis zum Kap der Guten Hoffnung beobachten.
Noch etwas anderes gehört in diesen Zusammenhang: Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war im Grunde eine strohgedeckte Lehmhütte. So etwas wurde schon immer und überall dort gebaut, wo es Schilf oder Gras, den richtigen Lehm und Pfähle für die Wände gab. Zum Beispiel bei den Angelsachsen. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, hatte vier Zimmer, eins neben dem anderen, und es war voller Bücher. Meine Eltern hatten nicht nur Bücher aus England mit nach Afrika gebracht, meine Mutter bestellte in England auch Bücher für ihre Kinder. Bücher in großen Paketen aus braunem Papier, und sie waren die Freude meines jungen Lebens. Eine Lehmhütte, aber voller Bücher.
Noch heute bekomme ich Briefe von Leuten, die in einem Dorf wohnen, in dem es vielleicht weder Strom noch fließendes Wasser gibt, wie bei unserer Familie in der langgestreckten Lehmhütte. „Ich werde auch Schriftsteller“, heißt es da, „denn mein Haus ist wie das, in dem Sie gewohnt haben.“
Liegt hier nicht das Problem?
Das Schreiben, ein Schriftsteller kommt nicht aus einem Haus ohne Bücher.
Da liegt der Unterschied. Da liegt das Problem.
Ich habe mir die Reden einiger Ihrer vorangegangenen Preisträger angesehen. Nehmen wir den großartigen Pamuk. Er sagt, dass sein Vater fünfzehnhundert Bücher besaß. Seine Begabung ist nicht vom Himmel gefallen, er war verbunden mit der großen Tradition.
Nehmen wir V.S. Naipaul. Er erwähnt, dass die indischen Veden ihren Platz im Gedächtnis seiner Familie hatten. Sein Vater machte ihm Mut zum Schreiben, und als er nach England kam, besuchte er die British Library. Also stand er der großen Tradition nahe.
Und nehmen wir John Coetzee. Er stand der großen Tradition nicht nur nahe, er war die Tradition: Er lehrte in Kapstadt Literatur. Ich bedaure es sehr, nie eines seiner Seminare besucht und von diesem wunderbar kühnen, mutigen Kopf gelernt zu haben.
Wenn man schreiben, wenn man Literatur produzieren will, muss man in enger Verbindung zu Bibliotheken stehen, zu Büchern, zur Tradition.
Ich habe einen Freund aus Simbabwe, einen schwarzen Schriftsteller. Er hat sich das Lesen selbst beigebracht, anhand der Etiketten auf Marmeladengläsern, der Etiketten auf Obstkonserven. Ich bin durch die Gegend gefahren, in der er aufgewachsen ist, eine ländliche Gegend, in der Schwarze wohnen. Auf der Erde liegen Splitt und Schotter, hier und da wachsen niedrige Büsche. Die Hütten sind ärmlich, ganz anders als die gepflegten Hütten der Wohlhabenderen. Eine Schule – aber so eine, wie ich sie beschrieben habe. Mein Freund hat auf einem Müllhaufen ein weggeworfenes Lexikon für Kinder gefunden und damit Lesen gelernt.
Als Simbabwe 1980 unabhängig wurde, gab es dort eine Gruppe guter Schriftsteller, „A Nest of Singing Birds“, ein wahres Singvogelnest. Sie entstammten dem alten Südrhodesien unter den Weißen – den Missionsschulen, den besseren Schulen. In Simbabwe werden keine Schriftsteller gemacht. Nicht ohne weiteres, nicht unter Mugabe.
Für all die Schriftsteller war es ein schwieriger Weg zum Lesen und Schreiben, vom Schriftstellerdasein ganz zu schweigen. Ich würde sagen, dass es gar nicht so ungewöhnlich war, anhand gedruckter Marmeladenglasetiketten und weggeworfener Lexika Lesen zu lernen. Und wir reden von Menschen, die nach einem Bildungsstandard hungerten, von dem sie weit entfernt waren, in ihren Hütten mit vielen Kindern – abgearbeitete Mütter, der ständige Kampf um Essen und Kleidung.
Doch trotz dieser Probleme wurden Menschen Schriftsteller. Und wir müssen bedenken, dass es hier um Simbabwe geht, das nicht einmal hundert Jahre zuvor erobert worden war. Vielleicht sind die Großeltern dieser Menschen Geschichtenerzähler gewesen, die die mündliche Tradition fortgesetzt haben. Innerhalb von ein, zwei Generationen erfolgte ein Übergang von den erinnerten und weitererzählten Geschichten hin zum Gedrucktem, zum Buch. Was für eine Errungenschaft.
Bücher, die buchstäblich Müllhaufen und den Abfällen der Welt der Weißen entrissen werden. Aber ein Packen Papier ist das eine, und ein veröffentliches Buch ist etwas ganz anderes. Man hat mir immer wieder Berichte über die Verlagslandschaft in Afrika geschickt. Selbst in privilegierteren Gegenden wie Nordafrika, wo die Traditionen anders sind, kann man von einer Verlagslandschaft nur träumen.
Hier rede ich nun von Büchern, die nie geschrieben wurden, von Schriftstellern, die es nicht geschafft haben, weil es die Verlage nicht gibt. Von ungehörten Stimmen. Diese ungeheure Vergeudung von Begabung, von Potenzial lässt sich gar nicht ermessen. Doch noch etwas fehlt, noch vor jenem Stadium in der Entstehung eines Buchs, in dem man einen Verlag, einen Vorschuss, Unterstützung braucht.
Schriftsteller werden oft gefragt: Wie schreiben Sie? Mit dem Computer? Einer elektrischen Schreibmaschine? Einem Federkiel? Mit der Hand? Die entscheidende Frage lautet aber: „Haben Sie den Raum gefunden, jenen leeren Raum, der Sie beim Schreiben umgeben muss?“ In diesen Raum, der wie eine Form des Lauschens, der Aufmerksamkeit ist, kommen nämlich die Worte, die Worte, die Ihre Figuren sagen werden, Ideen – Inspiration.
Wenn ein Schriftsteller diesen Raum nicht finden kann, werden Gedichte und Geschichten vielleicht tot geboren.
Wenn Schriftsteller miteinander reden, haben ihre Fragen immer mit diesem imaginären Raum zu tun, mit dieser anderen Zeit. „Hast du es gefunden? Hältst du es auch fest?“
Lassen Sie uns nun zu einem ganz anderen Schauplatz springen. Wir sind in London, in einer großen Stadt. Es gibt eine neue Schriftstellerin. Wir erkundigen uns zynisch: Sieht sie gut aus? Und wenn es ein Mann ist: Charismatisch? Attraktiv? Wir machen Witze, aber witzig ist das nicht.
Die Neuentdeckten werden beklatscht und bekommen vielleicht auch eine Menge Geld. In ihre armen Ohren dringt das Tosen der Paparazzi. Sie werden gefeiert, gepriesen, durch die ganze Welt gescheucht. Uns Alten, die wir das alles schon kennen, tut der Neuling leid, der keine Ahnung hat, was wirklich vorgeht.
Er, sie ist geschmeichelt und freut sich.
Doch wenn man nach einem Jahr fragt, was er oder sie nun denkt, dann heißt es: „Etwas Schlimmeres hätte mir gar nicht passieren können“ – das habe ich oft gehört.
Einige neue Schriftsteller haben nach so viel Öffentlichkeit nie wieder geschrieben, beziehungsweise nicht das geschrieben, was sie wollten, was sie vorgehabt hatten.
Und wir, die Alten, würden gern in solche unschuldigen Ohren flüstern: „Hast du deinen Raum noch? Deine Seele, deinen eigenen und unentbehrlichen Platz, wo deine eigenen Stimmen zu dir sprechen dürfen, zu dir allein, wo du träumen darfst. Oh, halt ihn, lass ihn nicht los.“
Ich habe lauter herrliche Erinnerungen an Afrika im Kopf, die ich wiederaufleben lassen und betrachten kann, wann immer ich will. Wie wäre es mit den Sonnenuntergängen in Gold und Purpur und Orange, die sich am Abend über den Himmel breiten. Wie wäre es mit Schmetterlingen und Faltern und Bienen auf den duftenden Büschen der Kalahari? Oder am mit bleichem Gras bewachsenen Ufer des Sambesi zu sitzen, wo das dunkle Wasser glänzt und alle Vögel Afrikas pfeilschnell umherfliegen. Ja, Elefanten, Giraffen, Löwen und so weiter, die gab es reichlich, aber wie wäre es mit dem Himmel bei Nacht, noch ohne jede Verschmutzung, schwarz und wunderbar und voller ruheloser Sterne.
Es gibt auch andere Erinnerungen. Ein junger Afrikaner, achtzehn vielleicht, steht weinend in seiner „Bibliothek“, die er einzurichten hofft. Ein Amerikaner hat bei einem Besuch eine Bibliothek ohne Bücher gesehen und eine Kiste geschickt. Der junge Mann hat sie alle einzeln ehrfürchtig herausgenommen und in Plastik gepackt. „Aber die Bücher wurden doch sicher geschickt, damit man sie liest?“, sagen wir. „Nein“, antwortet er, „dann werden sie schmutzig, und wo nehme ich dann wieder welche her?“
Wir sollen diesem jungen Mann Bücher aus England schicken, aus denen er das Unterrichten lernen kann. „Ich war nur vier Jahre in der Oberschule“, sagt er, „und unterrichten habe ich da nicht gelernt.“
Ich habe in einer Schule, in der es keine Schulbücher und nicht einmal Kreide für die Tafel gab, einen Lehrer gesehen. Er unterrichtete seine Klasse aus Sechs- bis Achtzehnjährigen, indem er Steine im Staub hin- und herschob und skandierte: „Zweimal zwei ist …“, und so weiter. Ich habe ein Mädchen gesehen, das vielleicht gerade einmal zwanzig war und auch keine Schulbücher, Hefte oder Kugelschreiber hatte, ich habe gesehen, wie sie für die Schüler das ABC mit einem Stöckchen in den Boden kratzte, unter der sengenden Sonne im wirbelnden Staub.
Wir werden hier Zeugen des großen Bildungshungers in Afrika, überall in der Dritten Welt, oder wie auch immer wir jene Teile der Welt nennen, in denen sich Eltern nach Bildung für ihre Kinder sehnen, die sie der Armut entreißt.
Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwo im südlichen Afrika und stehen im Laden eines Inders, in einer armen Gegend, zur Zeit einer schlimmen Dürre. Leute, meistens Frauen, stehen mit allerhand Wasserbehältern in einer Reihe an. Zu diesem Laden kommt jeden Nachmittag ein Tankwagen mit kostbarem Wasser aus der Stadt, und darauf warten die Leute hier.
Der Inder steht hinter dem Tresen, stützt sich mit den Handballen darauf ab und beobachtet eine Schwarze, die sich über einen Block Papier beugt, der aussieht wie aus einem Buch gerissen. Sie liest Anna Karenina.
Sie liest langsam und formt die Worte mit den Lippen. Anscheinend ein schwieriges Buch. Die Frau ist jung und hat zwei kleine Kinder, die sich an ihre Beine klammern. Sie ist schwanger. Der Inder ist bekümmert, denn das Kopftuch der jungen Frau, das eigentlich weiß sein sollte, ist gelb vom Staub. Staub liegt zwischen ihren Brüsten und auf ihren Armen. Der Mann ist bekümmert, weil so viele Leute anstehen, die alle Durst haben. Er hat nicht genügend Wasser für sie. Er ist wütend, weil er weiß, dass Menschen da draußen jenseits der Staubwolken sterben. Sein älterer Bruder hat im Laden die Stellung gehalten, dann hat er aber gesagt, dass er eine Pause braucht, und ist in die Stadt gefahren, ziemlich krank, wegen der Dürre.
Der Mann ist neugierig. Er sagt zu der jungen Frau: „Was liest du da?“
„Da geht es um Russland“, sagt das Mädchen.
„Weißt du, wo Russland liegt?“ Er weiß es selbst nur ungefähr.
Die junge Frau sieht ihn unverwandt und voller Würde an, obwohl ihre Augen vom Staub gerötet sind: „Ich war Klassenbeste. Meine Lehrerin hat gesagt, ich bin die Beste.“
Die junge Frau liest weiter. Sie will den Absatz zu Ende lesen.
Der Inder schaut die beiden kleinen Kinder an und greift nach einer Fanta, aber die Mutter sagt: „Von Fanta kriegen sie noch mehr Durst.“
Obwohl der Inder weiß, dass er das nicht tun sollte, greift er nach einem großen Plastikbehälter, der neben ihm hinter dem Tresen steht, und gießt Wasser in zwei Becher, die er den Kindern reicht. Er sieht zu, wie das Mädchen die Kinder beim Trinken betrachtet und wie sich ihr Mund bewegt. Er gibt ihr einen Becher Wasser. Es tut ihm weh, sie trinken zu sehen, so schrecklichen Durst hat sie.
Nun reicht sie ihm einen Wasserbehälter aus Plastik, und er macht ihn voll. Die junge Frau und die Kinder sehen aufmerksam zu, damit er nichts verschüttet.
Sie beugt sich wieder über das Buch. Sie liest langsam. Der Absatz fasziniert sie, und sie liest ihn noch einmal.
„Die schwarzhaarige Warenka mit dem weißen Kopftuch, umringt von den Kindern, mit denen sie sich gemütlich und heiter beschäftigte, und offensichtlich aufgeregt über die möglicherweise bevorstehende Aussprache mit dem Manne, der ihr gefiel, war äußerst anziehend. Sergej Iwanowitsch ging neben ihr und freute sich an ihrem Anblick. Er sah sie an und erinnerte sich aller freundlichen Worte, die er von ihr erfahren hatte; und er spürte immer deutlicher, dass sein Gefühl ihr gegenüber etwas ganz Besonderes war, das er nur von seiner frühesten Jugend her kannte. Die Freude über ihre Nähe wuchs mehr und mehr an, und schließlich, als er einen von ihm gefundenen mächtigen Riesenpilz auf dünnem Stiel mit umgebogenen Huträndern in ihren Korb gelegt hatte, sah er ihr in die Augen und bemerkte dabei, wie ihr Gesicht sich vor freudiger Spannung rötete. Er wurde dadurch selbst verwirrt und beantwortete ihr Lächeln schweigend mit einem Lächeln, das einem mehr als deutlichen Geständnis gleichkam.“*
Der Klotz aus bedrucktem Papier liegt auf dem Tresen, bei ein paar alten Zeitschriften, einzelnen Zeitungsseiten mit Bildern von Mädchen in Bikinis.
Es wird Zeit, dass die Frau diese Zuflucht, den Laden des Inders, verlässt und sich auf den Weg in ihr vier Meilen entferntes Dorf macht. Draußen zetern und schimpfen die Frauen, die dort Schlange stehen. Aber der Inder unternimmt noch nichts. Er weiß, was es dieses Mädchen kosten wird – nach Hause zu gehen, mit den beiden Kindern, die sich an sie klammern. Er würde ihr das Stück Prosa schenken, das sie so fasziniert, aber eigentlich glaubt er nicht, dass dieses zaundünne Mädchen mit dem dicken Bauch das wirklich versteht.
Warum liegt ungefähr ein Drittel von Anna Karenina auf diesem Tresen in einem abgelegenen indischen Laden herum? Es verhält sich so:
Ein gewisser hoher Beamter, zufällig von den Vereinten Nationen, hatte sich ein Exemplar dieses Romans im Buchladen gekauft, ehe er sich aufmachte, um mehrere Ozeane und Meere zu überqueren. Nachdem er es sich im Flugzeug in der Businessclass bequem gemacht hatte, riss er das Buch in drei Teile. Dabei sah er sich nach den anderen Passagieren um, weil er wusste, dass er erschrockene, neugierige und auch belustigte Blicke ernten würde. Als er richtig saß und den Gurt straffgezogen hatte, sagte er laut zu allen, die es hören konnten: „Das mache ich immer, wenn ich eine lange Reise vor mir habe. Wer will schon ein großes schweres Buch hochhalten.“ Der Roman war ein Taschenbuch, aber es stimmt, das Buch ist umfangreich. Der Mann ist es gewohnt, dass man ihm zuhört, wenn er etwas sagt. „Das mache ich immer, wenn ich reise“, gestand er. „Es ist heutzutage schon anstrengend genug, überhaupt zu reisen.“ Und als dann allmählich Ruhe einkehrte, schlug er seinen Teil von Anna Karenina auf und las. Wenn jemand in seine Richtung blickte, neugierig oder nicht, vertraute er ihm an: „Nein, reisen kann man eigentlich nur so.“ Er kannte und mochte den Roman, und diese außergewöhnliche Art des Lesens gab dem schließlich wohlbekannten Buch einen neuen Reiz.
Wenn er einen Teil des Buchs ausgelesen hatte, rief er die Stewardess herbei und ließ die betreffenden Kapitel seiner Sekretärin bringen, die auf einem billigeren Sitzplatz saß. Jedes Mal, wenn ein Teil des großen russischen Romans verstümmelt, aber lesbar im hinteren Teil des Flugzeugs ankam, rief das großes Interesse, Unmut und natürlich Neugier hervor. Diese raffinierte Art, Anna Karenina zu lesen, macht auf jeden Fall Eindruck, und wahrscheinlich hat sie niemand, der dabei war, vergessen.
Im Laden des Inders hält sich die junge Frau indessen am Tresen fest, und ihre kleinen Kinder klammern sich an ihre Röcke. Weil sie eine moderne Frau ist, trägt sie Jeans, doch darüber hat sie einen schweren Wollrock gezogen, der zur traditionellen Kleidung ihres Volkes gehört. Die Kinder können sich gut festhalten an den dicken Falten.
Sie wirft dem Inder, von dem sie weiß, dass er sie mag und dass sie ihm leid tut, einen dankbaren Blick zu, und dann tritt sie in den wehenden Staub hinaus.
Die Kinder sind schon jenseits des Weinens, und außerdem sind ihre Kehlen voller Staub.
Es war schwer, oh ja, es war schwer, so zu gehen, einen Fuß vor den anderen zu setzen, im Staub, der in weichen, trügerischen Wellen unter ihren Füßen lag. Schwer – aber das war sie ja schließlich gewohnt, nicht wahr? In Gedanken war sie bei der Geschichte, die sie gerade gelesen hatte. Sie dachte: Sie ist wie ich, mit dem weißen Kopftuch, und sie kümmert sich auch um Kinder. Ich könnte sie sein, die Russin. Und dieser Mann da, der liebt sie und wird sie fragen, ob sie ihn heiraten will. Sie hatte nur den einen Absatz zu Ende gelesen. Ja, denkt sie, zu mir kommt ein Mann und holt mich von all dem weg, mich und die Kinder, ja, er wird mich lieben und sich um mich kümmern.
Sie geht weiter. Der Wasserkanister lastet schwer auf ihren Schultern. Weiter geht es. Die Kinder hören, wie das Wasser schwappt. Auf halbem Weg bleibt sie stehen und setzt den Kanister ab. Die Kinder wimmern und greifen nach ihm. Sie denkt, dass sie ihn nicht öffnen kann, weil sonst Staub hineingeweht wird. Sie kann den Kanister erst öffnen, wenn sie zu Hause ist.
„Wartet“, sagt sie zu ihren Kindern, „wartet.“
Sie muss sich zusammenreißen und weitergehen.
Sie überlegt. Meine Lehrerin hat gesagt, dort gibt es eine Bibliothek, größer als der Supermarkt, ein großes Gebäude, das voller Bücher ist. Die junge Frau lächelt, während sie weitergeht und ihr der Staub ins Gesicht weht. Ich bin gescheit, denkt sie. Die Lehrerin hat gesagt, ich bin gescheit. Die Gescheiteste in der Schule – hat sie gesagt. Meine Kinder werden gescheit sein wie ich. Ich gehe mit ihnen in die Bibliothek, wo es so viele Bücher gibt, und dann gehen sie in die Schule, und dann werden sie Lehrer – meine Lehrerin hat gesagt, ich könnte Lehrerin sein. Meine Kinder werden weit weg von hier wohnen und Geld verdienen. Dann wohnen sie in der Nähe der Bibliothek und haben ein gutes Leben.
Sie werden vielleicht fragen, wie dieses Stück des russischen Romans überhaupt auf den Tresen im Laden des Inders geraten ist?
Das würde eine hübsche Geschichte abgeben. Vielleicht erzählt sie jemand.
Das arme Mädchen geht weiter, und der Gedanke, dass sie ihren Kindern zu Hause Wasser geben und selbst ein wenig trinken wird, hält sie aufrecht. Und sie geht weiter … durch den gefürchteten Staub einer Dürre in Afrika.
Wir sind ein übersättigter Haufen, wir in unserer bedrohten Welt. Mit Ironie und selbst Zynismus sind wir schnell bei der Hand. Manche Worte und Vorstellungen verwenden wir kaum, so abgenutzt sind sie. Aber vielleicht setzen wir ja manche Worte auch wieder ein, die ihre Macht verloren haben.
Wir haben eine Schatzkammer, eine Literatur, die bis zu den Ägyptern, den Griechen, den Römern zurückreicht. Er steht zur Verfügung, dieser Reichtum der Literatur, und jeder, der das Glück hat, auf ihn zu stoßen, kann ihn immer wieder neu entdecken. Einen Schatz. Angenommen, es gäbe ihn nicht. Wie verarmt wir wären, wie leer.
Wir besitzen ein Erbe an Sprachen, Gedichten, Geschichtsschreibung, das unerschöpflich ist. Es ist da, immer.
Wir haben ein Vermächtnis an Geschichten, Erzählungen der alten Geschichtenerzähler, deren Namen wir manchmal kennen und manchmal nicht. Geschichtenerzähler hat es immer gegeben, das reicht zurück bis hin zu einer Lichtung im Wald, auf der ein großes Feuer brennt und die alten Schamanen tanzen und singen, denn was wir an Geschichten ererbt haben, begann mit Feuer, mit Zauber, der Geisterwelt. Und dort wird es noch heute bewahrt.
Wenn man einen modernen Geschichtenerzähler fragt, wird er sagen, dass es immer einen Moment gibt, in dem ihn das Feuer berührt, das, was wir gerne als Inspiration bezeichnen, und das reicht bis zu den Anfängen unserer Spezies zurück, Feuer, Eis und die großen Winde, die uns und unsere Welt geformt haben.
Der Geschichtenerzähler ist tief in uns allen. Der Geschichten-Macher ist immer da. Nehmen wir an, dass unsere Welt durch einen Kreig verwüstet wird, durch jene Schrecken, die wir uns alle ohne Weiteres vorstellen können. Nehmen wir an, dass Fluten unsere Städte überspülen, dass die Meere ansteigen. Der Geschichtenerzähler wird da sein, denn es ist unsere Vorstellungskraft, die uns formt, erhält, erschafft – im Guten wie im Schlechten. Es sind unsere Geschichten, die uns wiedererschaffen, wenn wir zerrissen, verwundet, ja vernichtet sind. Es ist der Geschichtenerzähler, der Träume-Macher, der Mythen-Macher, der unser Phönix ist, der dann für uns steht, wenn wir am besten und am schöpferischsten sind.
Jenes arme Mädchen, das durch den Staub trottet und von Bildung für ihre Kinder träumt – glauben wir, dass wir besser sind als sie, wir, vollgestopft mit Lebensmitteln, die Schränke voller Kleider, die wir in unserem Überfluss ersticken?
Ich denke, dieses Mädchen und die Frauen, die über Bücher und Bildung sprachen, nachdem sie seit drei Tagen nichts gegessen hatten – es sind sie, an denen man doch erkennen kann, was wir sind.
Übersetzung von Barbara Christ
* Zitiert nach: Leo Tolstoi, Anna Karenina. Aus dem Russischen übersetzt von Fred Ottow. Deutscher Taschenbuch Verlag München, 17. Auflage, November 2006, S. 671f. © 1953/1993 Artemis & Winkler Verlags-AG, Düsseldorf und Zürich.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.