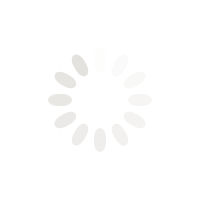Heinrich Böll – Nobel Lecture
Nobelvorlesung am 2. Mai 1973
Versuch über die vernunft der poesie
Es wird von denen, die es wissen müssten, gesagt – und von anderen, die es ebenfalls wissen müssten, bestritten – dass bei etwas anscheinend so Rationalem, Berechenbarem, von Architekten, Zeichnern, Ingenieuren, Arbeitern gemeinsam Erbrachtem wie einer Brücke ein paar Millimeter bis Zentimeter Unberechenbarkeit bleiben. Diese angesichts der behandelten und geformten Masse winzige Unberechenbarkeit mag in der Schwierigkeit begründet sein, eine Masse kompliziert miteinander verbundener chemischer und technischer Einzelheiten und Materialien in all ihren möglichen Reaktionen und dazu noch das Mitwirken der vier klassischen Elemente (Luft, Wasser, Feuer, Erde) genauestens vorauszuberechnen. Es scheint also da nicht allein der Entwurf, die immer wieder neu berechnete, kontrollierte technisch-chemisch-statistische Komposition das Problem zu sein, sondern – ich nenne es so – deren Verkörperung, die man auch Verwirklichung nennen kann. Diesen Rest Unberechenbarkeit, und mag er auch nur aus Bruchteilen von Millimetern bestehen, die unvorhersehbaren winzigen Dehnungsdifferenzen entsprechen – wie sollen wir ihn nennen? Was verbirgt sich in diesem Zwischenraum? Ist es das, was wir Ironie zu nennen pflegten, ist es Poesie, Gott, Widerstand, oder, modischer ausgedrückt, Fiktion? Jemand, der’s wissen musste, ein Maler, der früher einmal Bäcker gewesen war, erzählte mir einmal, dass auch das Brötchenbacken, das ja in den frühen Morgen-, fast Nachtstunden stattfand, eine äusserst riskante Sache gewesen sei; dass man Nase und Hintern in den grauenden Morgen habe hinaushalten müssen, um die Mischung von Ingredienzien, Temperatur, Backdauer mehr oder weniger instinktiv herauszufinden, denn jeder, jeder einzelne Tag habe seine eigenen Brötchen erfordert, dieses wichtige, sakramentale Element der ersten Morgenmahlzeit für alle jene, die die Mühsal des Tages auf sich nehmen. Sollen wir dies fast unberechenbare Element ebenfalls Ironie, Poesie, Gott, Widerstand oder Fiktion nennen? Wie kommen wir ohne es aus? Schweigen wir von der Liebe. Niemand wird je wissen, wieviele Romane, Gedichte, Analysen, Bekenntnisse, Schmerzen und Freuden auf diesen Kontinent Liebe gehäuft worden sind, ohne dass er sich als total erforscht erwiesen hätte.
Wenn ich gefragt werde, wie oder warum ich dieses oder jenes geschrieben habe, gerate ich immer wieder in erhebliche Verlegenheit. Ich möchte gern nicht nur dem Fragenden, auch mir selbst eine erschöpfende Auskunft geben, kann es aber in keinem Fall. Ich kann den gesammten Zusammenhang nicht wiederherstellen, und wünschte doch, ich könnte es, um wenigstens die Literatur, die ich selber mache, zu einem weniger mystischen Vorgang zu machen als das Brückenbauen und Brötchenbacken. Und da die Literatur nachweislich in ihrer Gesamtverkörperung, im Mitgeteilten und Geformten eine befreiende Wirkung haben kann, wäre es doch sehr nützlich, die Entstehung dieser Verkörperung mitzuteilen, auf dass noch mehr daran teilhaben. Was ist das, das ich selber, obwohl ich es nachweislich mache, nicht einmal annähernd erklären kann? Dieses Etwas, das ich von der ersten bis zur letzten Zeile eigenhändig zu Papier bringe, mehrfach variiere, bearbeite, partiell umakzentuiere, und das mir doch mit wachsendem zeitlichem Abstand fremd wird, wie etwas, das vorüber oder vorübergegangen ist und sich immer weiter von mir entfernt, während es für andere als geformte Mitteilung möglicherweise wichtig wird? Theoretisch müsste die totale Rekonstruktion des Vorgangs möglich sein, eine Art Parallelprotokoll, während der Arbeit erstellt, das, wäre es umfassend, wahrscheinlich den vielfachen Umfang der Arbeit selbst annehmen würde. Es müsste ja nicht nur den intellektuellen und spirituellen, auch den sinnlichen und materiellen Dimensionen gerecht werden, Ernährung, Stimmung, Stoffwechsel, Launen erklärt mitliefern, die Funktion der Umwelt nicht nur in deren Verkörperung als solche, auch als Kulisse. Ich schaue mir zum Beispiel manchmal in fast totaler Gedankenlosigkeit Sportreportagen an, um in dieser Gedankenlosigkeit Nachdenken zu üben, eine, wie ich zugebe, ziemlich mystische Übung, und doch müssten alle diese Reportagen mit ins Protokoll eingebracht werden, ungekürzt, denn es könnte ja sein, dass ein Kick oder ein Sprung irgendeinen Ausschlag in meiner gedankenlosen Nachdenklichkeit gibt, eine Handbewegung vielleicht, ein Lächeln, ein Reporterwort, eine Reklame. Es müsste jedes Telefongespräch, das Wetter, die Korrespondenz, jede einzelne Zigarette mit eingebracht werden, ein vorüberfahrendes Auto, ein Presslufthammer, das Gackern eines Huhns, das einen Zusammenhang stört.
Der Tisch, an dem ich dies schreibe, ist 76,5 cm hoch, seine Platte 69,5 mal 111 cm gross. Er hat gedrechselte Beine, eine Schublade, er mag siebzig bis achtzig Jahre alt sein, er stammt aus dem Besitz einer Grosstante meiner Frau, die ihn, nachdem ihr Mann in einem Irrenhaus verstorben war und sie in eine kleinere Wohnung zog, ihrem Bruder, dem Grossvater meiner Frau, verkaufte. So kam er, ein verachtetes und ziemlich verächtliches Möbelstück ohne jeden Wert, nachdem der Grossvater meiner Frau gestorben war, in unseren Besitz, stand irgendwo, niemand weiss genau wo, herum, bis er anlässlich eines Umzugs auftauchte und sich als bombengeschädigt erwies; irgendwo, irgendwann wurde die Platte während des Zweiten Weltkriegs von einem Bombensplitter durchbohrt – es hätte schon nicht nur sentimentalen Wert, wäre ein Einstieg in eine politisch-sozialgeschichtlich mitteilenswerte Dimension, den Tisch als Einstiegs-Vehikel zu benutzen, wobei die tödliche Verachtung der Möbelpacker, die sich beinahe weigerten, ihn noch zu transportieren, wichtiger wäre als seine gegenwärtige Verwendung, die zufälliger ist als die Hartnäckigkeit, mit der wir ihn – und das nicht aus sentimentalen oder Erinnerungsgründen, sondern fast aus Prinzip vor der Müllkippe bewahrten, und man mag mir, da ich inzwischen einiges an diesem Tisch geschrieben habe, eine vorübergehende Anhänglichkeit gestatten, die Betonung liegt auf vorübergehend. Schweigen wir von den Gegenständen, die auf dem Tisch liegen, sie sind nebensächlich und austauschbar, auch zufällig, ausgenommen vielleicht die Schreibmaschine Marke Remington, Ausführung „Travel Writer de Luxe”, Baujahr 1957, an der ich ebenfalls hänge, an diesem meinem Produktionsmittel, das fürs Finanzamt längst uninteressant geworden ist, obwohl es doch erheblich zu dessen Einnahmen beigetragen hat und immer noch beiträgt. Ich habe auf diesem Instrument, dass jeder Fachmann nur mit Verachtung anschauen oder anfassen würde, schätzungsweise vier Romane und einige hundert Items geschrieben, und nicht nur deshalb hänge ich daran, auch wiederum aus Prinzip, denn es tut’s noch und beweist, wie gering die Investitionsmöglichkeiten und der Investitionsehrgeiz eines Schriftstellers sind. Ich erwähne Tisch und Schreibmaschine, um mir klar darüber zu werden, dass nicht einmal diese beiden notwendigen Utensilien mir ganz erklärlich sind, und würde ich versuchen, ihrer beider Herkunft mit der erforderlichen exakten Gerechtigkeit zu eruieren, ihren genauen materiellen, industriellen, sozialen Werdegang und ihre Herkunft, es würde ein fast endloses Kompendium britischer und westdeutscher Industrie- und Sozialgeschichte daraus. Schweigen wir von dem Haus, von dem Raum, in dem dieser Tisch steht, von der Erde, auf der das Haus gebaut ist, schweigen wir erst recht von den Menschen, die es – wahrscheinlich einige Jahrhunderte lang bewohnt haben, von den Lebenden und Toten, schweigen wir von denen, die die Kohlen bringen, Geschirr spülen, Briefe und Zeitungen austragen – und schweigen wir erst recht von denen, die uns nah, näher, am nächsten sind. Und doch müsse alles, vom Tisch über die Bleistifte, die darauf liegen in seiner gesamten Geschichte eingebracht werden, einschliesslich derer, die uns nah, näher am nächsten sind. Bleiben da nicht genug Reste, Zwischenräume, Widerstände, Poesie, Gott, Fiktion – mehr noch als beim Brückenbau und beim Brötchenbacken ?
Es trifft zu und ist leicht gesagt, Sprache sei Material, und es materialisiere sich, wenn man schreibt, etwas. Wie aber könnte man erklären, dass da, – was gelegentlich festgestellt wird – etwas wie Leben entsteht, Personen, Schicksale, Handlungen – dass da Verkörperung stattfindet auf etwas so totenblassem wie Papier, wo sich die Vorstellungskraft des Autors mit der des Lesers auf eine bisher unerklärte Weise verbindet, ein Gesamtvorgang, der nicht rekonstruierbar ist, wo selbst die klügste, sensibelste Interpretation immer nur ein mehr oder weniger gelungener Annäherungsversuch bleibt, und wie wäre es erst möglich, jeweils den Übergang vom Bewussten ins Unbewusste – beim Schreibenden und beim Lesenden – mit der notwendigen totalen Exaktheit zu beschreiben, zu registrieren, und das dann auch noch in seiner nationalen, kontinentalen, internationalen, religiösen oder weltanschaulichen Verschiedenheit, und dazu noch das ständig wechselnde Mischungsverhältnis von beiden, bei beiden, dem Schreibenden und dem Lesenden und die plötzliche Umkehrung, wo das eine zum anderen wird, und in diesem plötzlichen Wechsel das eine vom anderen nicht mehr zu unterscheiden ist? Es wird immer ein Rest bleiben, mag man ihn Unerklärlichkeit nennen, Geheimnis meinetwegen, es bleibt und wird bleiben ein wenn auch winziger Bezirk, in den die Vernunft unserer Provenienz nicht eindringt, weil sie auf die bisher nicht geklärte Vernunft der Poesie und der Vorstellungskunst stösst, deren Körperlichkeit so unfassbar bleibt wie der Körper einer Frau, eines Mannes oder auch nur eines Tieres. Schreiben ist – für mich jedenfalls – Bewegung nach vorn, Eroberung eines Körpers, den ich noch gar nicht kenne, von etwas weg zu etwas hin, das ich noch nicht kenne; ich weiss nie, wie’s ausgeht, ausgehen hier nicht als Handlungsausgang im Sinne der klassischen Dramaturgie – ausgehen hier im Sinne eines komplizierten und komplexen Experiments, das mit gegebenem, erfundenem, spirituellem, intellektuellem und sinnlich auf einander gebrachtem Material Körperlichkeit – und das auf Papier! – anstrebt. Insofern kann es gar keine gelungene Literatur geben, könnte es auch keine gelungene Musik und Malerei geben, weil keiner den Körper, den er anstrebt, schon gesehen haben kann, und insofern ist alles, was man mit einem oberflächlichen Wort modern, was man besser lebende Kunst nennen sollte, Experiment und Entdeckung – und vorübergehend, nur in seiner historischen Relativität schätzbar und messbar, und es erscheint mir nebensächlich, von Ewigkeitswerten zu sprechen, sie zu suchen. Wo kommen wir ohne diesen Zwischenraum aus, diesen Rest, den wir Ironie, den wir Poesie, den wir Gott, Fiktion oder Widerstand nennen können?
Auch Staaten sind immer nur annähernd das, was sie zu sein vorgeben, und es kann keinen Staat geben, der nicht diesen Zwischenraum lässt zwischen der Verbalität seiner Verfassung und deren Verkörperung, einen Restraum, in dem Poesie und Widerstand wachsen – und hoffentlich gedeihen. Und es gibt keine Form der Literatur, die ohne diese Zwischenräume auskommt. Selbst die präziseste Reportage kommt nicht ohne Stimmung aus, ohne die Vorstellungskraft des Lesers, auch wenn der Schreibende sie sich selbst versagt; und selbst die präziseste Reportage muss auslassen – etwa die exakte und ausführliche Beschreibung von Gegenständen, die zur Verkörperung von Lebensumständen nun einmal gehören … sie muss komponieren, Elemente verschieben, und auch ihre Interpretation und ihr Arbeitsprotokoll ist nicht mitlieferbar, schon deshalb nicht, weil das Material Sprache nicht auf einen verbindlichen und allgemein verständlichen Mitteilungswert reduziert werden kann: Jedes Wort ist mit soviel Geschichte und Phantasiegeschichte, National- und Sozialgeschichte und historischer Relativität – die mitgeliefert werden müsste, – belastet, wie ich an Hand meines Arbeittisches anzudeuten versucht habe. Und die Festlegung der Mitteilungsweiten ist nicht nur ein Übersetzungsproblem von einer Sprache in die andere, es ist ein viel schwerer wiegendes Problem innerhalb der Sprachen, wo Definitionen Weltanschauungen und Weltanschauungen Kriege bedeuten können – ich erinnere nur an die Kriege nach der Reformation, die, wenn auch macht- und herrschaftspolitisch erklärbar, auch Kriege um religiöse Definitionen waren. Es ist – das nebenbei gesagt – deshalb belanglos festzustellen, man spreche doch die gleiche Sprache, wenn man nicht die Fracht, die jedes Wort regional- manchmal sogar lokalgeschichtlich haben kann, mit ausbreitet. Mir jedenfalls klingt manches Deutsch, das ich lese und höre, fremder als Schwedisch, von dem ich leider sehr wenig verstehe.
Politiker, Ideologen, Theologen und Philosophen versuchen immer und immer wieder, restlose Lösungen zu bieten, fix und fertig geklärte Probleme. Das ist ihre Pflicht – und es ist unsere, der Schriftsteller, – die wir wissen, dass wir nichts rest- und widerstandslos klären können – in die Zwischenräume einzudringen. Es gibt zu viele unerklärte und unerklärliche Reste, ganze Provinzen des Abfalls. Brückenbauer, Brötchenbäcker und Romanschreiber werden gewöhnlich mit den ihren fertig, und ihre Reste sind nicht die problematischsten. Während wir uns weiterstreiten über literature pure und literature engagée – eine der falschen Alternativen, ich werde darauf noch kommen – machen wir uns immer noch nicht bewusst – oder wir werden unbewusst davon abgelenkt – Gedanken über l’argent pure und l’argent engagée. Wenn man sich erst anschaut und anhört, wie Politiker und Nationalökonomen über etwas angeblich so rationales wie Geld sprechen, dann wird der mystische oder auch nur mysteriöse Bereich innerhalb der bisher erwähnten drei Berufe immer weniger interessant und verblüffend harmlos. Nehmen wir nur als Beispiel die kürzlich abgelaufene, höchst verwegene Dollarattacke (die man schamhaft eine Dollarkrise genannt hat). Mir tumbem Laien fiel da etwas auf, das niemand beim Namen nannte: dass zwei Staaten am heftigsten betroffen waren und am nachdrücklichsten zu etwas so Merkwürdigem – nimmt man an, dass das Wort Freiheit nicht wirklich bloss eine Fiktion ist – wie Stützungskäufen gezwungen, das heisst doch zur Kasse gebeten wurden, die historisch etwas gemeinsam haben: sie haben den zweiten Weltkrieg verloren, und man sagt ihnen noch etwas als gemeinsam nach: ihre Tüchtigkeit und ihren Fleiss. Kann man da dem, den’s angeht, der mit seinem Kleingeld in der Tasche klimpert oder mit seinen Scheinchen wedelt, die mit denkwürdigen Symbolen bedruckt sind, nicht klarmachen, warum er, obwohl er keineswegs weniger dafür arbeitet, diese ihm weniger Brot, Milch, Kaffee, Taxikilometer einbringen? Wieviel Zwischenräume bieten sich der Mystik des Geldes, und in welchen Tresoren wird deren Poesie versteckt? Idealistische Eltern und Erzieher haben uns immer einreden wollen, Geld sei schmutzig. Ich habe das nie eingesehen, weil ich immer nur Geld bekam, wenn ich gearbeitet hatte, – nehme ich den grossen Preis aus, den ich von der schwedischen Akademie verliehen bekam – und selbst die schmutzigste Arbeit wird für den, der keine andere Wahl hat, als zu arbeiten, rein. Sie bedeutet Lebensunterhalt für die, die ihm nahe sind und für ihn selbst. Geld ist die Verkörperung seiner Arbeit, und die ist rein. Zwischen Arbeit und dem, was sie einbringt, bleibt freilich immer ein ungeklärter Rest, der mit vagen Formulierungen wie gut oder schlecht verdienen weit weniger annähernd gefüllt ist als der Zwischenraum, den die Interpretation in einem Roman oder Gedicht lässt.
Die ungeklärten Reste der Literatur sind verglichen mit den unerklärten Zwischenräumen der Geldmystik von verblüffender Harmlosigkeit, und da gibt es dann immer noch Leute, die in sträflichem Leichtsinn das Wort Freiheit im Munde führen, wo eindeutig Unterwerfung unter einen Mythos und seinen Herrschaftsanspruch gefordert und geleistet wird. Da appeliert man dann an politische Einsicht, wo doch gerade Einsicht und Einblick in die Probleme verhindert wird. Auf dem unteren Rand meiner Schecks sehe ich vier verschiedene Zifferngruppen mit insgesamt 32 Zeichen, von denen zwei Hieroglyphen gleichen. Fünf dieser zweiunddreissig Zeichen sind mir einsichtig: drei für meine Kontonummer, zwei für die Zweigstelle der Bank – was ist mit den übrigen siebenundzwanzig, unter denen etliche Nullen sind? Ich bin sicher, es gibt für alle diese Zeichen eine vernünftige, sinnvolle – wie man so hübsch sagt: einleuchtende Erklärung. Nur habe ich in meinem Gehirn und meinem Bewusstsein keinen Platz für diese einleuchtende Erklärung, und was bleibt, ist die Ziffernmystik einer Geheimwissenschaft, die ich weniger durchschauen kann, deren Poesie und Symbolik mir fremder bleiben wird als Marcel Prousts „Suche nach der verlorenen Zeit” oder das „Wessobrunner Gebet”. Was diese 32 Ziffern von mir verlangen, ist vertrauensvoller Glaube an die Tatsache, dass alles schon seine Richtigkeit habe, dass alles restlos klar und, wenn ich mir nur ein wenig Mühe gäbe, für mich einsichtig sei, und doch wird für mich ein Rest Mystik bleiben – oder auch Angst, viel mehr Angst, als jede Erscheinungsform von Poesie mir einflössen könnte. Fast kein währungspolitischer Vorgang ist für die, um deren Geld es geht, einsichtig.
Dreizehn Ziffern auch auf meiner Telefonrechnung, einige auf jeder meiner soundsovielen Policen, dazu noch meine Steuer-, meine Auto- und Telefonnummer – ich nehme mir gar nicht die Mühe, alle diese Ziffern zu zählen, die ich im Kopf oder wenigstens notiert haben müsste, um meinen Platz in der Gesellschaft jederzeit exakt nachweisen zu können. Multiplizieren wir die 32 Ziffern und die Chiffren auf meinem Scheck getrost mit sechs, oder geben wir Rabatt und multiplizieren wir mit vier, fügen wir noch die Geburtsdaten hinzu, ein paar Abkürzungen für Konfession, Familienstand – haben wir dann endlich das Abendland in der Addition und Integration seiner Vernunft? Ist diese Vernunft, wie wir sie verstehen und hinnehmen – und es wird uns nicht nur einleuchtend gemacht, sondern leuchtet uns sogar ein – nicht vielleicht nur eine abendländische Arroganz, die wir dann noch via Kolonialismus oder Mission, oder in einer Mischung von beidem als Unterwerfungsinstrument in die ganze Welt exportiert haben, und werden oder würden für die Betroffenen die Unterschiede zwischen christlich, sozialistisch, kommunistisch, kapitalistisch nicht gering, mag ihnen auch die Poesie dieser Vernunft stellenweise einleuchten, bleibt nicht doch die Vernunft ihrer Poesie siegreich? Worin bestand das grösste Verbrechen der Indianer, als sie mit der nach Amerika exportierten europäischen Vernunft konfrontiert wurden? Sie kannten den Wert des Goldes, des Geldes nicht! Und sie kämpften gegen etwas, gegen das wir heute als das allerletzte Produkt unserer Vernunft kämpfen, gegen die Zerstörung ihrer Welt und Umwelt, gegen die totale Unterwerfung ihrer Erde unter den Profit, der ihnen fremder war als uns ihre Götter und Geister. Und was hätte ihnen daran wohl als christlich, als die neue, die frohe Botschaft einleuchten sollen, an dieser wahnwitzigen, heuchlerischen Selbstgefälligkeit, mit der man Sonntags Gott diente und ihn als Erlöser pries, und am Montag pünktlich die Banken wieder öffnete, wo die für einzig wahr gehaltene Vorstellung von Geld, Besitz und Profit verwaltet wurde? Für die Poesie des Wassers und des Windes, des Büffels und des Grases, in der sich ihr Leben verkörperte, gab es nur Hohn – und nun beginnen wir westlich Zivilisierten in unseren Städten, den Endprodukten unserer totalen Vernunft – denn gerechterweise muss man sagen: wir haben uns nicht geschont – wir beginnen etwas davon zu spüren, wie wirklich die Poesie des Wassers und des Windes ist und was sich in ihr verkörpert. Bestand oder besteht die Tragödie der Kirchen vielleicht gar nicht in dem, was man im Sinne der Aufklärung als unvernünftig an ihnen bezeichnen konnte, sondern in dem verzweifelten und auf verzweifelte Weise gescheiterten Versuch, einer Vernunft hinterherzurennen oder sie zu übernehmen, die niemals mit etwas so unvernünftigem wie dem verkörperten Gott zu vereinbaren gewesen war und wäre? Vorschriften, Paragraphen, Einverständnis der Fachleute, ein Ziffernwald von numerierten Vorschriften, und die Produktion von Vorurteilen, die man uns eingehämmert und auf die Laufbänder der Geschichtsunterweisung gesetzt hat, um die Menschen einander immer fremder zu machen. Schon im extremen Westen Europas steht unsere Vernunft einer ganz anderen gegenüber, die wir einfach Unvernunft nennen. Die entsetzliche Problematik Nordirlands besteht doch darin, dass hier zwei Arten Vernunft seit Jahrhunderten aufeinander und hoffnungslos aneinander geraten sind.
Wieviel Provinzen der Abfälligkeit und der Verächtlichkeit hat uns die Geschichte hinterlassen. Kontinente werden versteckt unter dem Siegeszeichen unserer Vernunft. Bevölkerungsgruppen blieben einander fremd, angeblich sprachen sie die gleiche Sprache. Wo man die Ehe abendländischer Provenienz als ordnendes Element verschrieb, unterschlug man die Tatsache, dass sie ein Privileg war: unerreichbar, unerschwinglich für die Landarbeiter etwa, die man Knechte und Mägde nannte, die einfach das Geld nicht hatten, sich auch nur ein paar Bettlaken zu kaufen, und hätten sie das Geld dazu gespart oder geklaut, kein Bett gehabt hätten, die Laken darüber zu breiten. So liess man sie ungerührt in ihrer Illegitimität, Kinder erbrachten sie ja! Nach oben und nach aussen schien immer alles restlos geklärt. Klare Antworten, klare Fragen, klare Vorschriften. Katechismustäuschung. Nur keine Wunder, und Poesie immer nur als Zeichen des Überirdischen, nie des Irdischen. Und dann wundert man sich, sehnt sich gar zurück nach alten Ordnungen, wenn die verachteten und versteckten Provinzen Zeichen von Aufruhr zeigen, und natürlich muss dann die eine Partei oder deren Gegenpartei aus diesem Aufruhr materiellen und politischen Profit ziehen. Den noch unerforschten Kontinent, den man geschlechtliche Liebe nennt, hat man mit Vorschriften zu ordnen versucht, die denen gleichen, wie man sie Anfängern in Philatelie beim Anlegen ihres ersten Albums anbietet. Bis ins peinlichste Detail wurden erlaubte und unerlaubte Zärtlichkeiten definiert, und plötzlich stellen Theo- und Ideologen in gemeinsamem Entsetzen fest, das auf diesem Kontinent, den man für ausgemessen, erkaltet und geordnet hielt, noch ein paar Vulkane nicht erloschen sind – und Vulkane kann man mit der erprobten Feuerwehr nun einmal nicht löschen. Und was hat man alles auf Gott, diese missbrauchte und bemitleidenswerte Instanz abgeladen, auf sie abgeschoben: alles, alles, was da an Problemen blieb: alle Wegweiser für auswegloses Elend sozialer, ökonomischer, sexueller Art wiesen auf ihn, alles Abfällige, Verächtliche wurde auf Gott geschoben, alle unerledigten ‘Reste’ und doch hat man ihn gleichzeitig als den Verkörperten gepredigt, ohne zu bedenken, dass man den Menschen nicht Gott und Gott nicht dem Menschen aufbürden kann, wenn er als verkörpert zu gelten hat. Und wer mag sich da wundern, wenn er da überlebt hat, wo man Gottlosigkeit verordnete und das Elend der Welt und der eigenen Gesellschaft auf einen unerfüllten Katechismus ebenso dogmatischer Art und auf eine immer weiter und immer wieder verschobene Zukunft schob, die sich als triste Gegenwart erwies? Und wiederum können wir auch darauf nur mit unerträglicher Arroganz reagieren, indem wir von hier aus uns anmassen, diesen Vorgang als reaktionär zu denunzieren; und es ist Arroganz gleicher Sorte, wenn ebenfalls von hier aus die amtlichen Verwalter Gottes diesen Gott, der in der Sowjetunion überlebt zu haben scheint, als ihren reklamieren, ohne die Müllhalden, unter denen er hier versteckt ist, wegzuräumen, und das Erscheinen Gottes dort für die Rechtfertigung eines Gesellschaftssystems hier reklamiert. Immer wieder wollen wir, ob wir uns nun als Christen oder Atheisten unserer Überzeugung brüsten, profitieren für das eine oder andere rechthaberisch vertretene Gedankensystem. Dieser unser Wahnwitz, dieser Hochmut „an sich” verschüttet immer wieder beides: den verkörperten Gott, den man den Menschgewordenen nennt, und die an seine Stelle gesetzte Zukunftsvision totaler Menschlichkeit. Uns, die wir so leicht demütigen, fehlt etwas: Demut, die nicht zu verwechseln ist mit Unterordnung, Gehorsam oder gar Unterwerfung. Das haben wir mit den kolonisierten Völkern gemacht: ihre Demut, die Poesie dieser Demut in Demütigung für sie verwandelt. Wir wollen immer unterwerfen und erobern, kein Wunder in einer Zivilisation, deren erste fremdsprachige Lektüre lange Zeit der Bellum Gallicum des Julius Caesar, und deren erste Einübung in Selbstgefälligkeit, in klipp und klare Antworten und Fragen der Katechismus war, irgendein Katechismus war, eine Fibel der Unfehlbarkeit und der restlos, fix und fertig geklärten Probleme.
Ich habe mich ein wenig vom Brückenbauen, Brötchenbacken und Romaneschreiben entfernt, die Zwischenräume, Ironien, fiktiven Bezirke, Reste, Göttlichkeiten, Mystifikationen und Widerstände anderer Bereiche angedeutet – mir erschienen sie schlimmer, aufklärungsbedürftiger als die geringfügigen, ungeklärten Ecken, in denen nicht die uns überkommene Vernunft, sondern die Vernunft der Poesie sich – etwa in einem Roman – verbirgt. Die ungefähr zweihundert Ziffern, die ich, in genauester Reihenfolge, Gruppe für Gruppe, mit ein paar Chiffren untermischt, im Kopf oder wenigstens auf einem Zettel als Beweis meiner Existenz haben müsste, ohne genau zu wissen, was sie bedeuten, verkörpern nicht viel mehr, als ein paar abstrakte Ansprüche und Existenzbeweise innerhalb einer Bürokratie, die sich nicht nur vernünftig gibt, sogar vernünftig ist. Ich bin darauf angewiesen und dazu angeleitet, ihr blind zu vertrauen. Darf ich nicht erwarten, dass man der Vernunft der Poesie nicht nur vertraut, sondern sie bestärkt, nicht dass man sie in Ruhe lasse, sondern ein wenig von ihrer Ruhe annehme und von dem Stolz ihrer Demut, die immer nur Demut nach unten, nie Demut nach oben sein kann. Respekt verbergen sich in ihr, Höflichkeit und Gerechtigkeit und der Wunsch, zu erkennen und erkannt zu werden.
Ich will hier keine neuen Missionseinstiege und -Vehikel liefern, aber ich glaube, im Sinne der poetischen Demut, Höflichkeit und Gerechtigkeit sagen zu müssen, dass ich viel Ähnlichkeit, dass ich Annäherungsmöglichkeiten sehe zwischen dem Fremden im Camusschen Sinne, der Fremdheit des Kafkaschen Personals und dem verkörperten Gott, der ja auch ein Fremder geblieben ist und – sieht man von ein paar Temperamentsentgleisungen ab – auf eine bemerkenswerte Weise höflich und wörtlich. Warum denn wohl hat die katholische Kirche lange – ich weiss nicht genau wie lange – den direkten Zugang zu den Wörtlichkeiten der für heilig erklärten Texte versperrt oder ihn in Latein und Griechisch versteckt gehalten, nur Eingeweihten zugänglich? Ich denke mir, um die Gefahren auszuschliessen, die sie in der Poesie des verkörperten Wortes witterte, und um die Vernunft ihrer Macht vor der gefährlichen Vernunft der Poesie zu schützen. Und nicht zufällig ist doch die wichtigste Folge der Reformationen die Entdeckung von Sprachen und ihrer Körperlicheit gewesen. Und welches Imperium ist je ohne Sprachimperialismus ausgekommen, das heisst, der Verbreitung der eigenen, Unterdrückung der Sprache der Beherrschten? In diesem, in keinem anderen Zusammenhang sehe ich die diesmal nicht imperialistischen, sondern scheinbar anti-imperialistischen Versuche, die Poesie, die Sinnlichkeit der Sprache, ihre Verkörperung und die Vorstellungskraft – denn Sprache und Vorstellungskraft sind eins – zu denunzieren und die falsche Alternative Information oder Poesie als eine neue Erscheinungsform des „divide et impera” einzuführen. Es ist die nagelneue, fast schon wieder internationale Arroganz einer Neu-Vernunft, die Poesie der Indianer als gegenherrschaftliche Kraft möglicherweise zuzulassen, den Klassen im eigenen Land, die man befreien möchte, die eigene aber vorzuenthalten. Poesie ist kein Klassenprivileg, sie ist nie eins gewesen. Immer wieder haben sich etablierte feudalistische und bürgerliche Literaturen regeneriert aus dem, was sie herablassend Volkssprache nannten, moderner ausgedrückt Jargon oder Slang. Man mag diesen Vorgang getrost sprachliche Ausbeutung nennen, aber man ändert an dieser Ausbeutung nichts, wenn man die falsche Alternative Information oder Poesie/Literatur propagiert. Die mit Nostalgie gemischte Abfälligkeit, die in den Ausdrücken Volkssprache, Slang, Jargon liegen mag, berechtigt nicht dazu, nun auch die Poesie auf den Abfallhaufen zu verweisen und alle Formen und Ausdrucksarten der Kunst dazu. Darin liegt viel Pfäffisches: anderen Verkörperung und Sinnlichkeit vorzuenthalten, indem man neue Katechismen ausarbeitet, wo von einzig richtigen und wahrhaft falschen Ausdrucksmöglichkeiten gesprochen wird. Man kann nicht die Kraft der Mitteilung von der Kraft des Ausdrucks, den diese Mitteilung findet, trennen; es bahnt sich da etwas an, das mich an die theologisch ziemlich langweiligen, als Beispiel von verweigerter Verkörperung aber wichtigen Streitereien um die Kommunion in beiderlei Gestalten erinnert, der dann, was den katholischen Teil der Welt betraf, auf die Blässe der Hostien reduziert wurde, die man ja nicht einmal Brot nennen konnte. Schweigen wir von den Millionen Hektolitern vorenthaltenem Wein! Es lag eine arrogante Verkennung nicht nur der Materie darin, mehr noch dessen, was diese Materie verkörpern sollte.
Man kann keine Klasse befreien, indem man ihr zunächst etwas vorenthält, und mag sich diese neue Schule des Manichäismus auch a- oder antireligiös geben, sie übernimmt damit ein kirchenherrschaftliches Modell, das mit der Verbrennung von Hus enden könnte und mit der Exkommunikation Luthers. Man mag getrost über den Begriff der Schönheit streiten, neue Ästhetiken entwickeln, sie sind überfällig, aber sie dürfen nicht mit Vorenthaltungen beginnen, und sie dürfen eins nicht ausschliessen: die Möglichkeit der Versetzung, die die Literatur bietet: sie versetzt nach Süd- oder Nordamerika, nach Schweden, Indien, Afrika. Sie kann versetzen, auch in eine andere Klasse, andere Zeit, andere Religion und andere Rasse. Es ist – sogar in ihrer bürgerlichen Form – niemals ihr Ziel gewesen, Fremdheit zu schaffen, sondern diese aufzuheben. Und mag man die Klasse, aus der sie bisher zum grössten Teil gekommen ist, für überfällig halten, als Produkt dieser Klasse war sie in den meisten Fällen auch ein Versteck des Widerstandes gegen sie. Und es muss die Internationalität des Widerstandes bewahrt bleiben, die den einen – Alexander Solschenizyn – gläubig erhalten oder gemacht hat – und den anderen – Arrabal – zum erbitterten und bitteren Gegner der Religion und der Kirche. Und dieser Widerstand ist nicht als blosser Mechanismus oder Reflex zu verstehen, der dort Gottglauben, da Gottlosigkeit hervorbringt, sondern als Verkörperung geistesgeschichtlicher Zusammenhänge, die sich zwischen verschiedenen Müllhalden und Provinzen der Abfälligkeit ergeben . und auch als Anerkennung der Zusammengehörigkeit ohne Arroganz und ohne Unfehlbarkeitsanspruch. Es mag für einen politischen Häftling oder auch nur isolierten Oppositionellen etwa in der Sowjetunion falsch oder gar wahnsinnig erscheinen, wenn man in der westlichen Welt gegen den Vietnamkrieg protestiert – man mag das psychologisch verstehen für ihn da in seiner Zelle oder seiner gesellschaftlichen Isolation – und doch müsste er erkennen, dass die Schuld der einen nicht aufgerechnet werden kann gegen die der anderen, dass, wenn für Vietnam demonstriert wird, für ihn mitdemonstriert wird! Ich weiss, das klingt utopisch, und doch erscheint es mir als die einzige Möglichkeit einer neuen Internationalität, nicht Neutralität. Kein Autor kann vorgegebene oder vorgeschobene Teilungen und Urteile übernehmen, und es erscheint mir als beinahe selbstmörderisch, wenn wir immer noch und immer wieder die Teilung in engagierte Literatur und die andere überhaupt diskutieren. Nicht nur, dass man, gerade, wenn man das eine zu sein glaubt, für das andere eintreten muss bis zum äussersten, nein wir übernehmen gerade mit dieser gefälschten Alternative ein bürgerliches Teilurigsprinzip, das uns entfremdet. Es ist nicht nur die Teilung unserer möglichen Stärke, auch die unserer möglichen – ich riskiere es ohne zu erröten – verkörperten Schönheit, denn sie kann ebenso befreien wie der mitgeteilte Gedanke, sie kann als sie selbst befreien oder als Provokation, die sie darstellen mag. Die Stärke der ungeteilten Literatur ist nicht die Neutralisierung der Richtungen, sondern die Internationalität des Widerstands, und zu diesem Widerstand gehört die Poesie, die Verkörperung, die Sinnlichkeit, die Vorstellungskraft und die Schönheit. Die neue manichäische Bilderstürmerei, die sie uns nehmen will, die uns die ganze Kunst nehmen will, würde nicht nur uns berauben, auch die, für die sie tut, was sie glaubt, tun zu müssen. Kein Fluch, keine Bitterkeit, nicht einmal die Information über den verzweifelten Zustand einer Klasse ist ohne Poesie möglich, und selbst, um sie zu verdammen, muss man sie erst zur Erkenntnis bringen. Man lese da doch einmal Rosa Luxemburg genau und schaue sich an, welche Denkmäler Lenin als erste verordnet hat: das erste für den Grafen Tolstoi, von dem er gesagt hat, bevor dieser Graf zu schreiben anfing, habe es in der russischen Literatur keine Bauern gegeben, das zweite für den „Reaktionär” Dostojewski. Man mag für sich selbst – um einen asketischen Weg der Veränderung zu wählen, auf Kunst und Literatur verzichten. Man kann das nicht für andere, bevor man ihnen nicht zur Kenntnis oder Erkenntnis gebracht hat, auf was sie verzichten sollen. Dieser Verzicht muss freiwillig sein, sonst wird er pfäffische Vorschrift wie ein neuer Katechismus, und wieder einmal würde ein ganzer Kontinent wie der Kontinent Liebe, zur Dürre verurteilt. Nicht aus blosser Spielerei und nicht nur, um zu schockieren, haben Kunst und Literatur immer wieder ihre Formen gewandelt, im Experiment neue entdeckt. Sie haben auch in diesen Formen etwas verkörpert, und es war fast nie die Bestätigung des Vorhandenen und Vorgefundenen; und wenn man sie ausmerzt, begibt man sich einer weiteren Möglichkeit: der List. Immer noch ist die Kunst ein gutes Versteck: nicht für Dynamit, sondern für geistigen Explosivstoff und gesellschaftliche Spätzünder. Warum wohl sonst hätte es die verschiedenen Indices gegeben? Und gerade in ihrer verachteten und manchmal sogar verächtlichen Schönheit und Undurchsichtigkeit ist sie das beste Versteck für den Widerhaken, der den plötzlichen Ruck oder die plötzliche Erkenntnis bringt.
Hier muss ich, bevor ich zum Schluss komme, eine notwendige Einschränkung machen. Die Schwäche meiner Andeutungen und Ausführungen liegt unvermeidlicherweise darin, das ich die Tradition der Vernunft, in der ich – hoffentlich nicht mit ganzem Erfolg – erzogen bin – mit den Mitteln ebendieser Vernunft anzweifle, und es wäre wohl mehr als ungerecht, diese Vernunft in allen ihren Dimensionen zu denunzieren. Offenbar ist es ihr – dieser Vernunft – immerhin gelungen, den Zweifel an ihrem Totalanspruch, an dem, was ich ihre Arroganz genannt habe, mitzuliefern und auch die Erfahrung mit und die Erinnerung an das zu erhalten, was ich die Vernunft der Poesie genannt habe, die ich nicht für eine priviligierte, nicht für eine bürgerliche Instanz halte. Sie ist mitteilbar, und gerade, weil sie in ihrer Wörtlichkeit und Verkörperung manchmal befremdend wirkt, kann sie Fremdheit oder Entfremdung verhindern oder aufheben. Befremdet zu sein hat ja auch die Bedeutung erstaunt zu sein, überrascht oder auch nur berührt. Und was ich über die Demut – natürlich nur andeutungsweise – gesagt habe, verdanke ich nicht einer religiösen Erziehung oder Erinnerung, die immer Demütigung meinte, wenn sie Demut sagte, sondern der frühen und späteren Lektüre von Dostojewski. Und gerade weil ich die internationale Bewegung nach einer klassenlosen, oder nicht mehr klassenbedingten Literatur, die Entdeckung ganzer Provinzen von Gedemütigten, für menschlichen Abfall erklärten für die wichtigste literarische Wendung halte, warne ich vor der Zerstörung der Poesie, vor der Dürre des Manichäismus, vor der Bilderstürmerei eines, wie mir scheint, blinden Eiferertums, das nicht einmal Badewasser einlaufen lässt, bevor es das Kind ausschüttet. Es erscheint mir sinnlos, die Jungen oder die Alten zu denunzieren oder zu glorifizieren. Es erscheint mir sinnlos, von alten Ordnungen zu träumen, die nur noch in Museen rekonstruierbar sind; es erscheint mir sinnlos, Alternativen wie konservativ/fortschrittlich aufzubauen. Die neue Welle der Nostalgie, die sich an Möbel, Kleider, Ausdrucksformen und Gefühlsskalen klammert, beweist doch nur, dass uns die neue Welt immer fremder wird. Dass die Vernunft, auf die wir gebaut und vertraut haben, die Welt nicht vertrauter gemacht hat, dass die Alternative rational/irrational auch eine falsche war. Ich musste hier vieles um- oder übergehen, weil ein Gedanke immer zum anderen und es zu weit führen würde, jeden einzelnen dieser Kontinente ganz auszumessen. Übergehen musste ich den Humor, der auch kein Klassenprivileg ist und doch ignoriert wird in seiner Poesie und als Versteck des Widerstands.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.