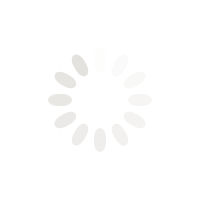V. S. Naipaul – Nobelvorlesung
English
Swedish
French
German
Zwei Welten
Dies ist eine ungewöhnliche Situation für mich. Ich habe Lesungen gehalten, jedoch keine Vorträge. Leuten, die mich bitten, einen Vortrag zu halten, sage ich, dass es nichts gibt, was ich vortragen könnte – und das ist die Wahrheit. Es mag seltsam erscheinen, dass ein Mann, der seit beinahe fünfzig Jahren mit Worten, Gefühlen und Ideen handelt, nicht ein paar davon erübrigen kann. Aber alles, was ich an Wertvollem zu sagen habe, steht in meinen Büchern. Und alles, was ich darüber hinaus in mir habe, ist noch nicht vollkommen ausgeformt. Ich bin mir seiner kaum bewusst; es wartet auf das nächste Buch. Es wird mir – wenn ich Glück habe – beim Schreiben bewusst werden und mich überrumpeln. Was ich beim Schreiben suche, ist dieses Element der Überrumpelung. Es ist die Richtschnur, nach der ich mein Tun beurteile – was nie leicht ist.
Proust hat den Unterschied zwischen dem Schriftsteller als Schriftsteller und dem Schriftsteller als gesellschaftlichem Wesen mit großem Scharfblick beschrieben. Seine Gedanken hierzu finden sich in einigen seiner Essays in dem Band Gegen Saint-Beuve, einem Buch, in dem seine frühen Schriften zusammengefasst sind.
Im neunzehnten Jahrhundert vertrat der französische Kritiker Sainte-Beuve die Ansicht, man müsse, um einen Schriftsteller verstehen zu können, so viel wie möglich über die Lebensumstände dieses Menschen in Erfahrung bringen. Eine verlockende These: Man bedient sich des Menschen, um sein Werk zu erhellen. Sie erscheint unwiderlegbar. Doch Proust zerpflückt sie auf sehr überzeugende Weise. “Diese Methode”, schreibt er, “verkennt, was ein etwas tieferer Umgang mit uns selbst uns lehrt: dass ein Buch das Erzeugnis eines anderen Ich ist als dessen, das wir in unseren Gewohnheiten, in der Gesellschaft, in unseren Lastern zutage treten lassen. Wenn wir versuchen wollten, dieses Ich zu verstehen, so kann uns das nur im Innersten von uns selbst gelingen, indem wir versuchen, es in uns nachzuschaffen.”
An diese Worte Prousts sollten wir denken, wenn wir die Biographie eines Schriftstellers lesen – oder die irgendeines Menschen, der auf das angewiesen ist, was man als Inspiration bezeichnen kann. Alle Einzelheiten dieses Lebens, alle Marotten, alle Freundschaftsbeziehungen mögen vor uns ausgebreitet sein, und dennoch wird das Schreiben ein Rätsel bleiben, das auch durch keine noch so faszinierende Fülle von Fakten entschlüsselt werden kann. In dieser Hinsicht muss die Biographie eines Schriftstellers – selbst wenn es sich um seine Autobiographie handelt – immer unvollständig sein.
Proust ist ein Meister der veranschaulichenden Übertreibung, und ich möchte noch ein wenig aus Gegen Sainte-Beuve zitieren. “In Wahrheit”, schreibt Proust, “gibt man dem Publikum das, was man für sich selbst geschrieben hat, was ganz das Werk von einem selbst ist. Was man im vertrauten Kreise gibt, das heißt in der Konversation (…) sowie in diesen Darbietungen, die für den vertrauten Kreis bestimmt sind, das heißt, die auf den Geschmack einiger Personen zugeschnitten und also kaum mehr als geschriebene Konversation sind, stellt das Werk eines viel äußerlicheren Ich dar, nicht aber des wahren Ich, das man nur findet, wenn man die anderen und das Ich, das die anderen kennt, ausschaltet.”
Als er dies schrieb, hatte Proust noch nicht das Thema gefunden, das ihn zum Lohn seiner großen literarischen Mühen führte. Den von mir gewählten Zitaten kann man entnehmen, dass er ein Mensch war, der auf seine Intuition vertraute und auf das Glück wartete. Ich habe diese Worte bereits zuvor und an anderer Stelle zitiert, und zwar, weil sie erhellen, wie ich selbst an das Schreiben herangehe. Ich habe auf meine Intuition vertraut. Das habe ich zu Beginn meines Schriftstellerlebens getan, und das tue ich auch heute noch. Ich habe keine Vorstellung davon, was aus dem, was ich begonnen habe, werden wird, wohin das, was ich schreibe, führen wird. Ich habe immer darauf vertraut, dass meine Intuition ein Thema finden wird, und darüber habe ich dann intuitiv geschrieben. Zu Beginn habe ich lediglich eine Idee, eine flüchtige Gestalt; selbst wenn ich ein Werk abgeschlossen habe, dauert es Jahre, bis ich es ganz und gar verstehe.
Vorhin habe ich darauf hingewiesen, dass alles, was ich an Wertvollem zu sagen habe, in meinen Büchern steht. Ich möchte noch weiter gehen: Ich bin die Summe meiner Bücher. Jedes dieser intuitiv erspürten und – im Fall meiner Romane – intuitiv erschaffenen Bücher baut auf den vorangegangenen Werken auf und erwächst aus ihnen. Ich glaube, man hätte zu jedem Zeitpunkt meiner schriftstellerischen Karriere sagen können, in meinem neuesten Buch seien alle vorherigen enthalten.
Der Grund hierfür ist die Welt, aus der ich stamme: Sie war überaus einfach und zugleich überaus kompliziert. Ich bin in Trinidad geboren. Das ist eine kleine Insel in der Mündung des großen Orinoko, der sich in Venezuela ins Meer ergießt. Sie gehört also eigentlich nicht zu Südamerika, eigentlich aber auch nicht zur Karibik. Ursprünglich war die Insel eine Plantagenkolonie in der Neuen Welt, und als ich 1932 dort geboren wurde, hatte sie ungefähr 400.000 Einwohner. Etwa 150.000 davon waren Inder – Hindus und Moslems -, beinahe alle stammten aus der Gangesebene und waren bäuerlicher Herkunft.
Das war die kleine Gemeinschaft, in der ich aufwuchs. Die meisten Migranten waren nach 1880 auf die Insel gekommen, und zwar zu folgenden Bedingungen: Die Einwanderer verpflichteten sich, fünf Jahre lang auf den Plantagen zu arbeiten; nach Ablauf dieser Frist erhielten sie ein kleines Stück Land – etwa fünf Morgen – oder eine Schiffspassage zurück nach Indien. Aufgrund der Proteste von Gandhi und anderen wurde dieses System der vertraglichen Leibeigenschaft 1917 abgeschafft. Und deshalb – oder aus irgendwelchen anderen Gründen – wurde das Versprechen, sie würden ein Stück Land oder eine Schiffspassage erhalten, bei vielen, die später eintrafen, nicht eingelöst. Diese Menschen waren absolut mittellos. Sie schliefen auf den Straßen der Hauptstadt Port of Spain. Als Kind sah ich sie. Wahrscheinlich wusste ich nicht, dass sie mittellos waren – dieser Gedanke kam mir vermutlich erst viel später -, und ich nahm sie kaum wahr. Sie gehörten zur Grausamkeit des Lebens in einer auf Plantagenwirtschaft gegründeten Kolonie.
Ich wurde in einer Kleinstadt namens Chaguanas geboren, wenige Kilometer vom Golf von Paria entfernt. In Hinblick auf Schreibweise und Aussprache war Chaguanas ein eigenartiger Name; von den Indern, die in dieser Gegend die Mehrheit bildeten, nannten viele die Stadt nach dem Namen einer indischen Kaste: Chauhan.
Ich war vierunddreißig, als ich herausfand, was es mit dem Namen meines Geburtsortes auf sich hatte. Das war in London; zu diesem Zeitpunkt lebte ich seit sechzehn Jahren in England. Ich arbeitete an meinem neunten Buch. Es handelte sich um eine Geschichte Trinidads, eine Geschichte seiner Bewohner, und ich versuchte, diese Menschen und ihre Geschichten wieder lebendig werden zu lassen. Ich verbrachte viel Zeit im British Museum und studierte spanische Dokumente über diese Region. Diese Dokumente – sie stammten aus spanischen Archiven – waren in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts anlässlich eines heftigen Grenzstreites mit Venezuela für die britische Regierung kopiert worden. Das erste stammte aus dem Jahr 1530, das letzte aus der Zeit, als das spanische Weltreich bereits im Untergang begriffen war.
Ich las von der törichten Suche nach El Dorado und dem brutalen Angriff des englischen Seehelden Sir Walter Raleigh. 1595 überfiel er Trinidad, tötete alle Spanier, derer er habhaft werden konnte, und fuhr, auf der Suche nach El Dorado, den Orinoko hinauf. Er fand nichts, doch als er nach England zurückgekehrt war, behauptete er, El Dorado entdeckt zu haben. Als Beweis legte er ein Stück Gold und etwas Sand vor. Er sagte, er habe das Gold mit einer Hacke aus einer Felswand am Ufer des Orinoko geschlagen. Die Experten der königlichen Münze befanden den Sand für wertlos, und andere äußerten den Verdacht, Raleigh habe den Goldklumpen vor seiner Fahrt nach Südamerika in Nordafrika erworben. Um seine Behauptungen zu untermauern, veröffentlichte Raleigh ein Buch. Vier Jahrhunderte lang hat man geglaubt, er habe tatsächlich etwas entdeckt. Das Buch ist eine recht schwere Lektüre, und der Zauber, der von ihm ausging, lag in seinem sehr langen Titel: Die Entdeckung des großen, reichen und schönen Reiches von Guayana, nebst einer Schilderung der großen und schönen Stadt Manoa (welche die Spanier El Dorado nennen) und der Provinzen Emeria, Aromaia, Amapaia und anderer Länder sowie ihrer Flüsse. Wie echt das klingt! Und dabei war er kaum über das Orinokodelta hinausgekommen.
Und dann wurde Raleigh – wie so mancher andere Betrüger – zum Opfer seiner eigenen Phantasien. Einundzwanzig Jahre später, als alter, kranker Mann, wurde er aus dem Gefängnis von London entlassen, damit er nach Guayana fahren konnte, zu der Goldmine, die er behauptete gefunden zu haben. Im Verlauf dieses von Anfang an unredlichen Unternehmens kam sein Sohn ums Leben. Um seine Reputation und sein Lügengebäude aufrechtzuerhalten, hatte der Vater seinen Sohn in den Tod geschickt. Voller Gram und ohne irgendetwas, für das zu leben sich lohnte, kehrte Raleigh nach London zurück und wurde hingerichtet.
Hier hätte die Geschichte enden sollen. Doch die Spanier hatten ein langes Gedächtnis, zweifellos weil die Postwege des weltumspannenden Reiches so lang waren: Es konnte zwei Jahre dauern, bis ein in Trinidad geschriebener Brief seinen Empfänger in Spanien erreichte. Acht Jahre später waren die Spanier in Trinidad und Guayana noch immer dabei, ihre offenen Rechnungen mit den am Golf ansässigen Indianerstämmen zu begleichen. Eines Tages las ich im British Museum einen Brief des spanischen Königs an den Gouverneur von Trinidad. Er war auf den 12. Oktober 1625 datiert.
“Ich habe euch angewiesen”, schrieb der König, “mir Nachricht zu geben über ein gewisses Indianervolk, das sich die Chaguanes nennt und das, wie Ihr sagt, aus mehr als eintausend Menschen besteht, die in ihrer Ruchlosigkeit die Engländer angeführt haben, als diese die Stadt überfielen und nahmen. Dieses Verbrechen ist bislang nicht bestraft worden, weil die dazu erforderlichen Kräfte nicht zur Verfügung standen und weil die Indianer keinen anderen Herren anerkennen als nur ihren eigenen Willen. Ihr habt beschlossen, sie zu bestrafen. Folgt also den Anweisungen, die ich euch gegeben habe, und berichtet mir von Euren Fortschritten.”
Welche Maßnahmen der Gouverneur ergriff, weiß ich nicht. In den Dokumenten des British Museum konnte ich keine weiteren Hinweise auf die Chaguanes entdecken. Vielleicht existieren sie irgendwo in den Bergen von Papier, die in Sevilla in den Archiven ruhen und den von der britischen Regierung entsandten Gelehrten nicht wichtig genug erschienen, um abgeschrieben zu werden. Tatsache ist jedoch: Der kleine, aus knapp über tausend Menschen bestehende Stamm – der vermutlich an beiden Ufern des Golfs von Paria gelebt hat – war so gründlich ausgelöscht worden, dass in der Stadt Chaguanas oder Chauhan niemand mehr etwas von ihm wusste. Und im Museum kam mir der Gedanke, dass ich seit 1625 der erste Mensch war, für den der Brief des spanischen Königs tatsächlich eine Bedeutung besaß. Und dieser Brief war erst 1896 oder 1897 aus den Archiven zutage gefördert worden. Eine Auslöschung – und dann das Schweigen der Jahrhunderte.
Wir lebten auf dem Land der Chaguanes. Ich war damals gerade eingeschult worden und kam auf dem Weg vom Haus meiner Großmutter zur Schule jeden Tag an den zwei oder drei Geschäften an der Hauptstraße, an dem chinesischen Schönheitssalon, dem Jubilee Theatre und der kleinen portugiesischen Fabrik mit ihrem stechenden Geruch vorbei, in der billige blaue Seife und billige gelbe Seife in langen Stangen hergestellt wurde, die morgens zum Trocknen und Aushärten in die Sonne gelegt wurden. Jeden Tag kam ich auf dem Weg zur Chaguanas Government School an diesen zeitlos wirkenden Gebäuden vorbei. Hinter der Schule erstreckte sich eine Zuckerrohrplantage bis zum Golf von Paria. Die Menschen, die von diesem Erdboden getilgt worden waren, hatten ihre eigene Landwirtschaft, ihren eigenen Kalender, ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen heiligen Stätten gehabt. Sie hatten die vom Orinoko erzeugten Strömungen im Golf von Paria gekannt. Nun waren sie mitsamt ihren Fertigkeiten und allem, was an sie hätte erinnern können, spurlos verschwunden.
Die Welt ist in ständiger Bewegung. Überall sind irgendwann Menschen vertrieben oder vernichtet worden. Dennoch war ich schockiert, als ich 1967 entdeckte, was am Ort meiner Geburt geschehen war, denn ich hatte nie etwas davon geahnt. Doch so – so blind – lebten die meisten von uns in dieser landwirtschaftlich geprägten Kolonie. Dabei gab es keinen Geheimplan der Regierung, uns in dieser Finsternis zu halten. Es war wohl eher so, dass dieses Wissen schlicht nicht vorhanden war. Erkenntnisse über die Chaguanes hätte man für unbedeutend gehalten – abgesehen davon, dass man sie nicht leicht hätte gewinnen können. Schließlich handelte es sich um ein kleines Volk von Ureinwohnern. Wir kannten solche Menschen – sie lebten in Britisch Guayana, einem Land, das wir B.G. nannten -, und für uns waren sie Witzfiguren. Leute, die laut waren und sich schlecht benahmen, wurden wohl von allen Gesellschaftsgruppen in Trinidad als Warrahoons bezeichnet. Ich dachte, das sei ein erfundenes Wort, das auf Wildheit hindeuten sollte; erst als ich mit über vierzig Jahren durch Venezuela fuhr, stellte ich fest, dass der Name eines recht großen indianischen Volkes, das dort lebt, ganz ähnlich klingt.
Als Kind hörte ich eine alte Geschichte, die mich mittlerweile sehr stark berührt: Zu gewissen Zeiten kamen Ureinwohner in ihren Kanus vom Kontinent und gingen durch den Wald im Süden der Insel zu einer Stelle, wo sie bestimmte Früchte pflückten oder eine Art Opfer darbrachten. Anschließend fuhren sie wieder über den Golf von Paria zurück in ihr nasses Land im Delta des Orinoko. Dieser Ritus muss außerordentlich bedeutsam gewesen sein, sonst hätte diese Geschichte nicht die Ausrottung der Ureinwohner von Trinidad und vierhundert Jahre historischer Umwälzungen überdauert. Vielleicht sind diese Menschen – obgleich die Flora in Trinidad dieselbe ist wie in Venezuela – auch nur gekommen, um eine bestimmte Sorte Früchte zu ernten. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendwer danach gefragt hätte. Und heute ist die Erinnerung daran verloren gegangen, und der heilige Ort ist – wenn es ihn überhaupt je gegeben hat – öffentliches Land geworden.
Was vergangen war, war vergangen. Ich glaube, das war die allgemeine Haltung. Wir Inder jedenfalls, wir Einwanderer aus Indien, hatten diese Haltung gegenüber Trinidad. Die meisten von uns lebten ein ritualisiertes Leben und waren noch nicht zu jener Selbsteinschätzung imstande, die das Lernen überhaupt erst ermöglicht. Die Hälfte von uns, die wir auf dem Land der Chaguanes lebten, gab sich den Anschein – oder vielleicht war es auch gar kein Anschein, sondern ein niemals ausformuliertes Gefühl -, als hätten wir eine Art Indien mitgebracht, das wir gleichsam wie einen Teppich auf dem Land ausrollen konnten.
Das Haus meiner Großmutter in Chaguanes bestand aus zwei Gebäuden. Das vordere war gemauert, verputzt und weiß gestrichen. Mit seiner großen, von einer Balustrade eingefassten Terrasse im ersten Stock und einem Gebetsraum in der Etage darüber glich es einem indischen Haus. Die Verzierungen waren aufwendig – Lotos-Kapitelle an den Säulen, hinduistische Gottheiten – und stammten allesamt von Leuten, die nach der Erinnerung arbeiteten. In Trinidad galt es als eine architektonische Besonderheit. Hinter diesem Gebäude und durch einen Brückenraum mit ihm verbunden war ein Holzhaus im französisch-karibischen Stil. Das Eingangstor lag an der Seite, zwischen den beiden Häusern. Es war hoch und bestand aus einem Holzrahmen, auf den man Wellblech genagelt hatte. Es erzeugte einen Eindruck von dezidierter Privatheit.
Als Kind war ich also zwei Welten ausgesetzt: der Welt außerhalb des hohen Wellblechtors und der Welt zu Hause – oder jedenfalls der Welt im Haus meiner Großmutter. Es war ein Überbleibsel unseres Kastenbewusstseins, jener Geisteshaltung, die andere ausgrenzte. In Trinidad, wo wir als Neuankömmlinge zu einer benachteiligten Bevölkerungsschicht gehörten, war dieses ausgrenzende Bewusstsein eine Art Schutz: Es ermöglichte uns – eine Zeit lang, nur eine Zeit lang -, auf unsere Weise und nach unseren Regeln zu leben, in unserem eigenen, allmählich verblassenden Indien. Das führte zu einer außerordentlich starken Selbstbezogenheit. Unser Blick ging nach innen; wir lebten unser Leben; die Welt dort draußen existierte in einer Art Finsternis; wir stellten keine Fragen.
Nebenan war ein Geschäft, das einem Moslem gehörte. Die kleine Loggia des Geschäftes meiner Großmutter stieß an die fensterlose Außenwand seines Hauses. Der Mann hieß Mian. Das war alles, was wir von ihm und seiner Familie wussten. Gewiss haben wir ihn hin und wieder gesehen, doch ich habe kein Bild von ihm vor Augen. Wir wussten nichts von Moslems. Zu diesen fremden Elementen, die es auszuschließen galt, gehörten auch andere Hindus. So aßen wir beispielsweise mittags Reis und abends Weizen. Es gab jedoch merkwürdige Menschen, die diese natürliche Reihenfolge umkehrten und abends Reis aßen. Diese Menschen erschienen mir fremd – man darf nicht vergessen, dass ich zu jener Zeit keine sieben Jahre alt war, denn als ich sieben war, fand mein Leben im Haus meiner Großmutter in Chaguanas ein Ende. Wir zogen erst in die Hauptstadt und dann in das Hügelland im Nordwesten.
Doch die Denkgewohnheiten, die aus diesem Leben des Eingrenzens und Ausgrenzens entstanden waren, hatten noch eine ganze Weile Bestand. Ohne die Kurzgeschichten meines Vaters hätte ich so gut wie nichts über das Leben unserer indischen Gemeinde erfahren. Diese Geschichten vermittelten mir mehr als bloßes Wissen. Sie gaben mir so etwas wie Festigkeit. In dieser Welt waren sie ein Boden unter meinen Füßen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Weltbild ohne diese Geschichten ausgesehen hätte.
Die Welt dort draußen existierte in einer Art Finsternis, und wir stellten keine Fragen. Ich war gerade alt genug, um noch eine gewisse Vorstellung von den indischen Epen, insbesondere vom Ramayama, zu bekommen. Die Kinder, die in unserer großen Familie etwa fünf Jahre nach mir kamen, hatten nicht dieses Glück. Niemand lehrte uns Hindi. Manchmal schrieb uns jemand das Alphabet auf, damit wir es lernten, doch das war auch schon alles; um den Rest sollten wir uns selbst bemühen. So verloren wir, während das Englische sich immer mehr durchsetzte, unsere eigene Sprache. Im Haus meiner Großmutter war die Religion sehr präsent; es gab viele Zeremonien und Lesungen aus heiligen Schriften – manche dauerten Tage. Doch uns, die wir die Sprache nicht verstanden, wurde nichts erklärt oder übersetzt. Und so schwand der Glaube unserer Vorväter und wurde zu etwas Nebulösem, das in keiner Verbindung zu unserem täglichen Leben stand.
Wir stellten keine Fragen über Indien oder die Familien, die man dort zurückgelassen hatte. Als unsere Denkweise sich änderte und wir diese Fragen stellten, war es zu spät. Ich weiß nichts über die Familie meines Vaters, ich weiß nur, dass sie zum Teil aus Nepal stammte. Vor zwei Jahren schickte mir ein freundlicher Nepalese, dem mein Name gefiel, die Kopien einiger Seiten aus einem britischen Verzeichnis aus dem Jahr 1872, einem Werk mit dem Titel Hindu Castes and Tribes as Represented in Benares; unter einer Vielzahl von Namen finden sich auch die jener Nepalesen in der heiligen Stadt Benares, die den Namen Naipal trugen. Das ist alles, was ich weiß.
Außerhalb dieser Welt im Haus meiner Großmutter, wo wir mittags Reis und abends Weizen aßen, lag das große Unbekannte: diese Insel mit nur vierhunderttausend Einwohnern. Da waren die Afrikaner, die Leute afrikanischer Abstammung, die die Mehrheit bildeten. Sie waren Polizisten und Lehrer. Eine Afrikanerin war meine erste Lehrerin in der Chaguanas Government School; ich verehrte sie noch jahrelang. Da war die Hauptstadt; dorthin würden wir alle bald gehen, um eine Ausbildung aufzunehmen, einen Job zu finden, uns unter Fremden niederzulassen. Da waren die Weißen, die nicht alle Engländer waren, und die Portugiesen und Chinesen, die wie wir irgendwann eingewandert waren. Und da waren, geheimnisvoller als die anderen, die Leute, die wir Spanier – ‘pagnols – nannten, Mischlinge mit einer Hautfarbe in warmen Brauntönen, deren Vorfahren zur Zeit der Spanier hierher gekommen waren, vor der Loslösung der Insel von Venezuela und dem spanischen Reich. Sie blickten auf eine Geschichte zurück, die über meinen kindlichen Horizont ging.
Um Ihnen diese Vorstellung von der Welt, aus der ich stamme, zu vermitteln, musste ich auf Erkenntnisse und Gedanken zurückgreifen, die mir erst viel später kamen, in erster Linie durch das Schreiben. Als Kind wusste ich beinahe nichts, nur das, was ich im Haus meiner Großmutter aufgeschnappt hatte. Wahrscheinlich sind alle Kinder so: Sie wissen nicht, wer sie sind. Doch auf ein französisches Kind zum Beispiel wartet dieses Wissen. Es lebt inmitten dieses Wissens. Es nimmt dieses Wissen indirekt auf, aus Gesprächen zwischen Älteren, aus Zeitungen, aus dem Radio. Und in den Schulen vermittelt das Werk von Generationen von Gelehrten, in Bearbeitungen für den Unterricht, eine gewisse Vorstellung von Frankreich und den Franzosen.
Ich war ein aufgeweckter Junge, und doch war ich in Trinidad von Ländern der Finsternis umgeben. Die Schule erklärte mir nichts. Ich wurde mit Fakten und Formeln voll gestopft. Ich musste alles auswendig lernen; für mich war alles abstrakt. Ich sage es noch einmal: Ich glaube nicht, dass es einen Plan gab, dem zufolge wir in dieser Finsternis zu belassen seien. Wir bekamen einen ganz normalen Schulunterricht. In einer anderen Umgebung hätte er durchaus einen Sinn gehabt. Und dass er seinen Zweck verfehlte, lag zum Teil sicher auch an mir selbst. Angesichts des begrenzten Horizonts, mit dem ich aufwuchs, bereitete es mir große Schwierigkeiten, mich in andere oder weit entfernte Gesellschaften einzufühlen. Ich mochte Bücher, doch es fiel mir schwer, sie zu lesen. Am besten gefielen mir Bücher wie die von Andersen oder Äsop – deren Geschichten spielten zu einer unbestimmten Zeit an einem unbestimmten Ort und grenzten mich nicht aus. In der sechsten Klasse schließlich, der höchsten auf dem College, fand ich Gefallen an einigen literarischen Texten – Moliere, Cyrano de Bergerac -, vermutlich, weil sie etwas Märchenhaftes hatten.
Als ich Schriftsteller wurde, fand ich meine Themen in diesen Ländern der Finsternis, zwischen denen ich aufgewachsen war. Das Land; die Ureinwohner; die Neue Welt; die Kolonie; die Geschichte; Indien; die Welt der Moslems, zu der ich ebenfalls eine Beziehung hatte; Afrika; schließlich England, wo ich das alles zu Papier brachte. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass meine Bücher aufeinander aufbauen und dass ich die Summe meiner Bücher bin. Das habe ich gemeint, als ich sagte, die Welt, aus der ich stamme, sei überaus einfach und zugleich überaus kompliziert gewesen. Ich habe gezeigt, wie einfach sie in einer Kleinstadt wie Chaguanas war, und ich glaube, Sie werden begreifen, wie kompliziert sie für mich als Schriftsteller war, besonders anfangs, denn die literarischen Vorbilder, die ich hatte – und die mir durch einen in meinen Augen ungeeigneten Unterricht vermittelt wurden -, befassten sich mit gänzlich anderen Gesellschaften. Vielleicht glauben Sie jedoch, das vorgefundene Material sei so reichhaltig gewesen, dass es mir eigentlich hätte leicht fallen müssen, einen Anfang zu machen und darauf aufzubauen. Was ich über meine Herkunft gesagt habe, entspringt den Erkenntnissen, die ich beim Schreiben gewonnen habe. Und Sie müssen mir glauben, wenn ich sage, dass das Muster meines Werkes mir erst vor etwa zwei Monaten bewusst geworden ist. Man las mir Passagen aus früheren Büchern vor, und ich sah die Verbindungen. Bis dahin hatte ich immer größte Schwierigkeiten gehabt, mein Werk zu beschreiben und zu erklären, woraus es besteht.
Ich war, wie gesagt, ein Schriftsteller, der auf die Intuition vertraute. Das war damals so, und daran hat sich bis heute, da mein Leben sich dem Ende zuneigt, nichts geändert. Ich verfolgte nie einen Plan. Ich hatte kein System. Ich habe intuitiv geschrieben. Mein Ziel war jedes Mal, ein Buch zu schreiben, das leicht und interessant zu lesen ist. Und in jedem Stadium konnte ich nur auf meine Erkenntnisse, meine Empfindungen, mein Talent, meine Weltsicht zurückgreifen. All dies entwickelte sich mit jedem Buch weiter. Und die Bücher, die ich geschrieben habe, musste ich schreiben, weil ich in denen, die es über das betreffende Thema bereits gab, nicht fand, was ich gesucht hatte. Ich musste meine Welt erhellen, ich musste sie mir selbst erklären.
Um ein echtes Gespür für die Geschichte der Kolonie zu entwickeln, musste ich Dokumente im British Museum und anderswo studieren. Ich musste nach Indien fahren, weil es niemanden gab, der mir hätte sagen können, wie das Indien meiner Großeltern ausgesehen hatte. Ich las die Schriften von Nehru und Gandhi; und eigenartigerweise war es Gandhi mit seinem südafrikanischen Hintergrund, der mir mehr gab, wenn auch nicht genug. Ich las Kipling; ich las Kolonialschriftsteller wie John Masters (dessen Bücher sich in den fünfziger Jahren noch immer gut verkauften – das Vorhaben, eine Serie von fünfunddreißig inhaltlich zusammenhängenden Romanen über Britisch-Indien zu veröffentlichen, wurde leider aufgegeben); ich las von Frauen verfasste Liebesromane. Die wenigen indischen Schriftsteller, deren Bücher zu jener Zeit erschienen, waren Großstädter aus der Mittelschicht. Das Indien, aus dem meine Familie stammte, war ihnen unbekannt.
Und als mein Bedürfnis, Indien kennen zu lernen, gestillt war, tauchten andere auf: Afrika, Südamerika, die muslimische Welt. Ich wollte stets mein Weltbild erweitern; dieses Streben hat seine Wurzeln in meiner Kindheit: Ich will mich wohler fühlen mit mir selbst. Freundliche Menschen haben mir geschrieben und vorgeschlagen, ich solle doch etwas über Deutschland oder China schreiben. Doch es gibt bereits viele gute Bücher über diese Länder, und ich bin bereit, mir anhand dessen, was in ihnen steht, ein Bild zu machen. Diese Themen überlasse ich anderen. Sie waren nicht die Länder der Finsternis, von denen ich als Kind umgeben war. Es gibt also eine Entwicklung in meinem Werk, eine Entwicklung der erzählerischen Fertigkeiten, des Wissens und der Empfindsamkeit, doch obgleich ich vielleicht den Eindruck erweckt habe, mich in viele verschiedenen Richtungen zu bewegen, gibt es darin auch eine Geschlossenheit, einen Fokus.
Als ich zu schreiben begann, hatte ich keinerlei Vorstellung von dem, was vor mir lag. Ich wollte bloß ein Buch schreiben. Ich wollte in England schreiben, wo ich nach meinem Studium geblieben war, und hatte das Gefühl, dass meine Erfahrungen sehr spärlich waren – nicht der Stoff, aus dem man Bücher machen konnte. In keinem Buch fand ich irgendetwas, das der Welt, der ich entstammte, nahe kam. Ein junger Engländer oder Franzose, der Schriftsteller werden will, kann sich an zahlreichen Vorbildern orientieren. Ich hatte kein einziges. Die Geschichten meines Vaters, die sich mit unserer indischen Lebenswelt befassten, gehörten der Vergangenheit an. Meine eigene Welt war vollkommen anders: urbaner, uneinheitlicher. Es erschien mir unmöglich, die einfachsten Gegebenheiten des chaotischen Lebens unserer großen Familie schriftstellerisch zu bewältigen – die Schlafzimmer oder Schlafplätze, die Essenszeiten, die schiere Zahl meiner Verwandten. Es gab zu vieles, das ich hätte erklären müssen, sowohl in Hinblick auf das Leben zu Hause als auch in Hinblick auf die Welt dort draußen. Und zugleich gab es auch in meiner Familie zu vieles, das ich nicht kannte: meine Vorfahren, unsere Geschichte.
Schließlich kam mir eines Tages der Gedanke, ich könnte mit der Straße in Port of Spain beginnen, in die wir von Chaguanas gezogen waren. In Port of Spain gab es kein hohes Wellblechtor, das die Außenwelt ausgrenzte. Das Leben auf der Straße lag vor mir. Es bereitete mir großes Vergnügen, es von der Veranda aus zu verfolgen. Ich begann, über dieses Leben zu schreiben. Um allzu große Selbstzweifel zu vermeiden, wollte ich schnell schreiben, und darum vereinfachte ich. Ich gab keine Auskunft über die Herkunft des Kindes, das die Geschichten erzählte. Ich ignorierte die rassische und gesellschaftliche Vielschichtigkeit des Lebens, das sich dort abspielte. Ich blieb sozusagen auf dem Boden und stellte die Menschen dar, wie sie sich selbst auf der Straße darstellten. Ich schrieb jeden Tag eine Geschichte. Die ersten waren sehr kurz. Ich war besorgt, das Material könnte nicht ausreichen. Doch der Zauber des Schreibens begann zu wirken, und das Material floss mir aus vielen Quellen zu. Die Geschichten wurden länger; ich konnte sie nicht mehr an einem Tag schreiben. Und dann erlosch die Inspiration, die mir in einem anderen Stadium einfach zugeflogen war und mich getragen hatte. Dennoch: Ich hatte ein Buch geschrieben und war in meinen Augen zum Schriftsteller geworden.
Mit den beiden nächsten Büchern wuchs die Distanz zwischen dem Schriftsteller und seinem Material, und der Blick weitete sich. Und dann führte mich die Intuition zu einem großen Buch über das Leben in unserer Familie. Als ich es schrieb, nahm mein Ehrgeiz zu, doch als es fertig war, hatte ich das Gefühl, mein Insel-Material verbraucht zu haben. Ganz gleich, wie sehr ich darüber nachdachte – es kamen keine Geschichten mehr.
Der Zufall rettete mich. Ich wurde zum Reisenden. Ich reiste in die Karibik und begriff viel mehr als zuvor von der kolonialen Situation, in der ich aufgewachsen war. Ich verbrachte ein Jahr in Indien, dem Land meiner Vorväter; es war eine Zäsur in meinem Leben. Die Bücher, die ich über diese beiden Reisen schrieb, eröffneten mir neue Gefühlswelten, verhalfen mir zu einer Weltsicht, wie ich sie bis dahin nicht gekannt hatte, und machten meinen Stil geschmeidiger. In dem Roman, zu dem ich danach inspiriert wurde, konnte ich sowohl England als auch die Karibik verarbeiten – welche Mühsal! Ich war auch in der Lage, alle auf der Insel versammelten Rassen darzustellen, und das war mir noch nie zuvor gelungen.
Dieser neue Roman handelte von kolonialer Schande und kolonialen Phantasien, er handelte davon, wie die Machtlosen über sich selbst und gegenüber sich selbst lügen, denn Lügen sind das Einzige, über das sie reichlich verfügen. Das Buch hieß The Mimic Men, doch es geht darin nicht um Mimik, sondern um Männer in einem Kolonialland, die (in einer Art Mimikri) eine echte Männlichkeit vortäuschen und sich selbst nach und nach in allen Belangen misstrauen. Neulich hat man mir aus diesem Buch vorgelesen – ich hatte seit über dreißig Jahren keinen Blick mehr hineingeworfen -, und mir wurde bewusst, dass ich über koloniale Schizophrenie geschrieben hatte. Damals dachte ich darüber allerdings anders. Nie habe ich meine Absichten beim Schreiben in abstrrakten Begriffen dargestellt. Wenn ich das getan hätte, wäre ich nicht imstande gewesen, das Buch zu schreiben. Ich folgte der Intuition, und das konnte ich nur, weil ich genau beobachtet hatte.
Mit diesem kleinen Überblick über die Frühzeit meines Schriftstellerlebens wollte ich die Stadien der Veränderung oder Entwicklung schildern, die mein Geburtsort innerhalb von nur zehn Jahren in meinen Büchern durchlief: von der Komödie des Straßenlebens zu einer Studie über eine weitverbreitete Form der Schizophrenie. Was einfach gewesen war, war kompliziert geworden.
Meinen Blick verdanke ich sowohl dem Roman als auch der Reiseliteratur, und daher ist es wohl verständlich, dass ich alle Literaturformen für gleichermaßen wertvoll halte. So merkte ich, als ich – sechsundzwanzig Jahre nach dem ersten – ein drittes Buch über Indien schrieb, dass das Wesentliche bei einem Reisebuch die Menschen sind, unter denen man sich bewegt. Die Menschen sollten sich selbst definieren. Es war ein ganz einfacher Gedanke, doch er erforderte eine neue Art von Buch; er erforderte eine neue Art des Reisens. Es war dieselbe Methode, die ich später noch einmal anwandte, als ich zum zweiten Mal durch die moslemische Welt reiste.
Ich habe mich immer allein von der Intuition leiten lassen. Ich habe kein System, weder in literarischer noch in politischer Hinsicht. Es gibt keinen politischen Leitgedanken, an dem ich mich orientiere. Das hat wahrscheinlich etwas mit meiner Herkunft zu tun. Der in diesem Jahr verstorbene indische Schriftsteller R.K. Narayan vertrat keine politische Idee. Mein Vater, der seine Kurzgeschichten ohne Bezahlung in einer sehr finsteren Zeit schrieb, vertrat keine politische Idee. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir viele Jahrhunderte lang fern einer Obrigkeit gelebt haben. Das ermöglicht uns eine besondere Perspektive. Ich habe den Eindruck, wir neigen eher dazu, in allem das Komische und das Mitleiderregende zu sehen.
Vor beinahe dreißig Jahren fuhr ich nach Argentinien. Es war zu einer Zeit, als das Land kurz vor einem Guerillakrieg zu stehen schien. Man rechnete damit, dass der ehemalige Diktator Perón aus dem Exil zurückkehren würde. Überall war Hass. Viele Peronisten warteten darauf, alte Rechnungen zu begleichen. Einer von ihnen sagte zu mir: “Es gibt gute Folter, und es gibt schlechte Folter.” Gute Folter war das, was man mit den Feinden des Volkes machte. Schlechte Folter war das, was die Feinde des Volkes mit einem selbst machten. Die Leute auf der anderen Seite sagten dasselbe. Es gab keine echten Debatten über irgendetwas. Es gab nur Leidenschaften und den nachgeplapperten politischen Jargon Europas. Ich schrieb: “Wo der Jargon lebendige Themen zu Abstraktionen macht und wo der eine Jargon schließlich mit einem anderen Jargon konkurriert, haben die Menschen keine Ziele mehr. Sie haben nur noch Feinde.” Und die Leidenschaften, die ich in Argentinien vorfand, sind immer noch am Werk, sie knechten die Vernunft und verschlingen Menschenleben. Eine Lösung ist nicht in Sicht.
Mein Werk neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich bin froh, dass ich getan habe, was ich getan habe, ich bin froh, dass ich mich in schöpferischer Hinsicht so weit vorangetrieben habe, wie ich konnte. Weil ich stets intuitiv geschrieben habe und weil mein Material so erstaunlich war, erscheint mir jedes Buch wie ein Segen. Jedes Buch hat mich verblüfft; bis zu dem Augenblick, in dem ich es zu schreiben begann, wusste ich nicht, dass es da war. In meinen Augen ist jedoch das größte Wunder, dass es mir gelungen ist, einen Anfang zu machen. Ich habe das Gefühl – und ich kann mich noch heute lebhaft an die Angst davor erinnern -, dass ich leicht hätte scheitern können, bevor ich ernsthaft angefangen hatte.
Ich will diesen Vortrag beenden, wie ich ihn begonnen habe: mit einem Zitat von Proust aus einem der wunderbaren kleinen Essays in Gegen Sainte-Beuve. “Wenn wir Talent besitzen”, sagt Proust, “ruhen die schönen Dinge, die wir schreiben, in uns, undeutlich wie die Erinnerung an eine Melodie, die uns erfreut, obgleich wir nicht imstande sind, sie ins Bewusstsein zu rufen. Diejenigen, die von dieser verschwommenen Erinnerung an Wahrheiten besessen sind, welche sie nie erfahren haben, sind begnadet. (…) Talent ist wie eine Art Erinnerung, die die Menschen schließlich in Stand setzt, diese undeutliche Musik in sich aufzunehmen, sie klar zu hören, sie niederzuschreiben …”
Talent, sagt Proust. Ich würde sagen: Glück und viele Mühen.
Deutsch von Dirk van Gunsteren.
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 12 laureates' work and discoveries range from proteins' structures and machine learning to fighting for a world free of nuclear weapons.
See them all presented here.