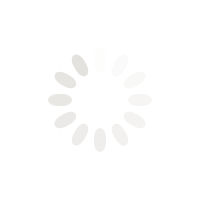Jean-Marie Gustave Le Clézio – Nobelvorlesung
English
Swedish
French
German
7. Dezember 2008
Im Wald der Paradoxe
Warum schreibt man? Ich nehme an, dass jeder eine Antwort auf diese einfache Frage hat. Die Veranlagung, das Milieu, die Umstände spielen dabei eine Rolle. Auch die Dinge zu denen man nicht fähig ist. Wenn man schreibt, bedeutet das, dass man nicht handelt. Dass man eine gewisse Schwierigkeit angesichts der Realität empfindet und sich daher für eine andere Art der Reaktion entscheidet, für eine andere Form der Kommunikation, für eine gewisse Distanz, für eine Zeit der Überlegung.
Wenn ich die Umstände näher betrachte, die mich dazu veranlasst haben zu schreiben – ich tue das nicht aus Eitelkeit, sondern weil ich um Genauigkeit bemüht bin -, dann muss ich feststellen, dass für mich der Krieg den Ausgangspunkt bildet. Nicht der Krieg als große Umwälzung, als ein Erlebnis historischer Stunden, wie er zum Beispiel während der Kampagne in Frankreich auf beiden Seiten des Schlachtfelds von Valmy geschildert worden ist, von Goethe auf deutscher Seite und von meinem Vorfahren François auf Seiten der französischen Revolutionsarmee. Das muss etwas Mitreißendes und Ergreifendes gewesen sein. Nein, ich verbinde mit dem Krieg vor allem das, was die Zivilbevölkerung und insbesondere die Kinder in jener Zeit erlebt haben. Zu keinem Zeitpunkt ist mir der Krieg als ein historischer Moment vorgekommen. Wir waren nur einfach hungrig, hatten Angst und uns war kalt. Ich habe, wie ich mich noch entsinne, unter meinem Fenster die Truppen von Feldmarschall Rommel vorüberziehen sehen, die einen Fluchtweg durch die Alpen nach Norditalien und Österreich suchten. Doch das hat keine bleibenden Spuren in meinem Gedächtnis hinterlassen. Ich erinnere mich dagegen noch sehr gut daran, wie es mir in den darauf folgenden Jahren an allem gefehlt hat, vor allem an Schreibmaterial und Büchern. In Ermangelung von Papier und Füllfederhalter habe ich auf der Rückseite der Lebensmittelkarten Zeichnungen angefertigt und meine ersten Worte geschrieben, und zwar mit einem roten und blauen Zimmermannsstift. Davon habe ich eine Vorliebe für raues Schreibpapier und einfache Bleistifte zurückbehalten. In Ermangelung von Kinderbüchern, habe ich die Lexika meiner Großmutter gelesen. Das waren wunderbare Tore, um die Welt zu erkunden, durch unbekannte Gebiete zu streichen und vor Bildtafeln, Karten und Listen unbekannter Worte zu träumen. Das erste Buch, das ich im Alter von sechs oder sieben Jahren geschrieben habe, trug übrigens den Titel Le Globe à mariner. Darauf folgte sofort die Biographie eines imaginären Königs namens Daniel III. – vielleicht war er ja ein schwedischer König… Und eine Erzählung aus der Perspektive einer Möwe. Es war eine Zeit, in der ich zurückgezogen gelebt habe. Kinder durften damals kaum draußen spielen, weil die Grundstücke und Gärten in der Nähe des Hauses meiner Großmutter vermint waren. Ich erinnere mich noch, wie ich bei einem Spaziergang an einem mit Stacheldraht umzäunten Gelände am Meeresufer entlang gegangen bin, vor dem ein Schild mit einem Totenkopf und der Aufschrift „Betreten verboten“ in deutscher und französischer Sprache angebracht war.
Ich kann verstehen, dass man unter solchen Bedingungen den Wunsch hat zu fliehen – also zu träumen und seine Träume aufzuschreiben. Außerdem war meine Großmutter mütterlicherseits eine ausgezeichnete Erzählerin, die uns an den langen Nachmittagen Geschichten erzählte. Ihre Märchen waren immer sehr phantasievoll und spielten in einem Wald – vielleicht in Afrika oder im Wald von Macchabée auf Mauritius – und die Hauptperson war ein pfiffiger Affe, der es verstand, sogar mit der gefährlichsten Situation fertig zu werden. Anschließend habe ich längere Zeit in Afrika verbracht und habe dort den richtigen Wald kennen gelernt, in dem es kaum Tiere gibt. Aber ein District Officer aus dem Dorf Obudu an der kamerunischen Grenze hat mich auf den Lärm der Gorillas aufmerksam gemacht, die in den benachbarten Hügeln auf ihre Brust trommelten. Von diesem Aufenthalt in Nigeria, wo mein Vater mitten im Busch als Arzt tätig war, habe ich nicht den Stoff für zukünftige Romane, sondern so etwas wie eine zweite Persönlichkeit mitgebracht, die verträumt und zugleich von der Wirklichkeit fasziniert ist und mich mein ganzes lang Leben begleitet hat – sie stellt die widersprüchliche, mir selbst fremde Seite dar, die ich sehr oft und manchmal geradezu schmerzhaft empfunden habe. Das Leben ist bisweilen von solch einer Langsamkeit, dass ich den größten Teil meiner Existenz gebraucht habe, um zu verstehen, was das bedeutet.
Mit Büchern habe ich erst später Bekanntschaft gemacht. Und zwar war es meinem Vater gelungen, mehrere Buchbestände zu retten und zu vereinen, die aus der Aufteilung seines Erbes stammten, nachdem er aus seinem Geburtshaus in Moka auf der Insel Mauritius vertrieben worden war. Und da habe ich die Wahrheit begriffen, die Kindern nicht sofort klar wird, nämlich dass Bücher einen viel kostbareren Schatz darstellen als Immobilien oder Bankkonten. In diesen zumeist alten, in Leder gebundenen Büchern habe ich die großen Texte der Weltliteratur entdeckt, den von Tony Johannot illustrierten Don Quijote, La vida de Lazarillo de Tormes, The Ingoldsby Legends, Gulliver’s Travels; die großen Romane voller Inspiration von Victor Hugo, Quatre-vingt-Treize, Les Travailleurs de la Mer oder L’Homme qui rit sowie Les Contes drôlatiques von Balzac. Aber die Bücher, die mich am stärksten geprägt haben, sind die Reiseberichte, die zumeist Indien, Afrika oder den Maskarenen gewidmet sind, sowie die großen Texte der Forschungsreisenden Dumont d’Urville, Abbé Rochon, Bougainville, Cook und natürlich Das Buch von den Wundern der Welt von Marco Polo. In dem langweiligen Leben einer kleinen sonnigen, verschlafenen Provinzstadt haben diese Bücher nach den Jahren der Freiheit in Afrika meine Abenteuerlust geweckt und mir erlaubt, die Größe der realen Welt zu ermessen, sie mit dem Instinkt und den Sinnen zu erforschen anstatt mit Hilfe des Wissens. Auf gewisse Weise haben sie mir sehr früh erlaubt, die widersprüchliche Natur des Lebens eines Kindes zu empfinden, das sich einen Zufluchtsort bewahrt, wo es Gewalt und Konkurrenzkampf vergessen und sich daran erfreuen kann, das Leben draußen durch ein Fenster seines Zimmers zu betrachten.
In den Stunden vor der für mich sehr überraschenden Ankündigung, dass mir die Schwedische Akademie ihre Auszeichnung verleiht, war ich gerade dabei, ein kleines Buch von Stig Dagerman noch einmal zu lesen, das ich besonders liebe: eine Sammlung seiner politischen Schriften mit dem Titel Essäer och texter. Es war kein Zufall, dass ich mich wieder in die Lektüre dieses bissigen, bitteren Buchs vertieft hatte. Ich hatte nämlich geplant nach Schweden zu fahren, um dort den Preis entgegenzunehmen, den mir die Stig-Dagerman-Gesellschaft im vergangenen Sommer zugesprochen hatte, und um die Geburtsstätte dieses Schriftstellers zu besuchen. Ich bin schon immer sehr empfänglich gewesen für Dagermans Feder, für diese Mischung aus jugendlicher Zärtlichkeit, Naivität und Sarkasmus. Für seinen Idealismus. Für die Scharfsicht, mit der er die Wirren der Nachkriegszeit beurteilt, die für ihn die Zeit der Reife und für mich die meiner Kindheit ist. Ein Satz hat mein Interesse besonders geweckt, ich hatte das Gefühl, als richte er sich genau in diesem Augenblick an mich – nachdem ich gerade einen Roman mit dem Titel Ritournelle de la Faim veröffentlicht hatte. Dieser Satz oder, genauer gesagt, diese Passage lautet so: „Wie ist es zum Beispiel möglich, dass man sich einerseits so verhält, als gäbe es nichts auf der Welt, was wichtiger sei als die Literatur, während es andererseits unmöglich ist, die Augen davor zu verschließen, dass andernorts die Menschen mit dem Hunger kämpfen und gezwungen sind, das Wichtigste darin zu sehen, was sie am Ende des Monats verdienen? Denn er (der Schriftsteller) stößt auf ein neues Paradox: Er, der eigentlich nur für jene schreiben möchte, die Hunger leiden, muss entdecken, dass nur diejenigen, die genug zu essen haben, die Muße haben, seine Existenz wahrzunehmen.“ (Der Schriftsteller und das Bewusstsein)
Dieser „Wald der Paradoxe“, wie Stig Dagerman es nennt, ist der Bereich des Schreibens, der Ort, von dem der Künstler nicht versuchen darf zu fliehen, sondern wo er im Gegenteil „sein Zelt aufschlagen“ muss, um jede Einzelheit zu erkennen, jeden Weg zu erforschen und jeden Baum zu benennen. Es ist nicht immer ein angenehmer Aufenthalt. Der Autor, der sich in Sicherheit glaubt, die Autorin, die sich ihrer Manuskriptseite wie einer engen, nachsichtigen Freundin anvertraut, sind plötzlich mit der Wirklichkeit konfrontiert und zwar nicht nur als Beobachter sondern als Handelnde. Sie müssen Partei ergreifen, Abstand nehmen. Cicero, Rabelais, Condorcet, Rousseau, Madame de Staël oder in jüngster Zeit Solschenizyn, Hwang Seok-Yong, Abdelatif Laâbi und Milan Kundera waren gezwungen, ins Exil zu gehen. Für mich, der ich immer – bis auf die kurze Zeit während des Krieges – die Möglichkeit gehabt habe, mich frei zu bewegen, ist das Verbot, an dem Ort zu leben, den man gewählt hat, ebenso unannehmbar wie Freiheitsentzug.
Aber dieses Privileg, sich frei zu bewegen, zieht ein Paradox nach sich. Sehen Sie sich den Baum mit aufgerichteten Nadeln in dem Wald an, den der Schriftsteller bewohnt: Dieser Mann oder diese Frau, die damit beschäftigt sind zu schreiben und ihre Träume zu erfinden, gehören sie nicht der äußerst glücklichen, begrenzten Kaste der happy few an? Stellen wir uns einmal eine Schrecken einflößende Extremsituation vor – und zwar genau jene, in der sich die Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde befindet. Jene Situation, die früher, zur Zeit von Aristoteles oder zur Zeit von Tolstoi, die Namenlosen erlebt haben – die Leibeigenen, die Diener, die Bauern Europas im Mittelalter oder die überfallenen Völker der afrikanischen Küsten während der Aufklärung, die auf der Insel Gorée, in El Mina oder auf Sansibar verkauft wurden. Und selbst heute, während ich zu Ihnen spreche, all diejenigen, denen man das Wort verweigert, die jenseits der Sprache leben. Mir stehen die pessimistischen Gedanken Dagermans näher als Gramscis engagierte Analyse oder Sartres ernüchtertes Setzen auf den freien Willen. Die Tatsache, dass die Literatur der Luxus einer herrschenden Klasse ist und sich von Vorstellungen und Bildern nährt, die der Mehrzahl der Menschheit fremd sind, ruft ein Unbehagen hervor, das jeder von uns empfindet – damit meine ich jene, die lesen und schreiben. Man könnte versucht sein, diese Botschaft jenen zu bringen, die davon ausgeschlossen sind, und sie großzügig zum Bankett der Kultur einzuladen. Warum ist das so schwer? Die schriftlosen Völker, wie die Anthropologen sie so gern nennen, haben es geschafft, mit Hilfe von Gesängen und Mythen eine alles umfassende Kommunikation zu erfinden. Warum ist das heute in unseren Industrienationen unmöglich geworden? Muss die Kultur neu erfunden werden? Müssen wir zu einer direkten, unvermittelten Kommunikation zurückkehren? Man könnte glauben, dass der Film heute diese Rolle spielt oder die Popmusik mit ihren Reimen und Rhythmen, zu denen sich gut tanzen lässt. Vielleicht der Jazz, oder in anderen Breiten der Calypso, der Maloya, der Séga.
Das Paradox ist nicht neu. François Rabelais, der größte französischsprachige Dichter, hat seinerzeit der affektierten Gelehrsamkeit der Professoren der Sorbonne den Kampf angesagt, indem er ihnen Worte an den Kopf warf, die der volkstümlichen Sprache entstammten. Hat er für jene gesprochen, die Hunger litten? Ausschweifungen, Rausch, Schlemmerei. Er kleidete für die Dauer einer Maskerade, einer verkehrten Welt, den außerordentlichen Appetit derer in Worte, die sich von der Magerkeit der Bauern und Arbeiter ernährten. Das Paradox der Revolution sowie der epische Ritt des Ritters von der traurigen Gestalt leben im Bewusstsein jedes Schriftstellers fort. Wenn seine Feder eine unerlässliche Tugend besitzt, dann jene, dass sie nie zum Lob der Mächtigen dienen darf, und sei es auch nur ein leichtes Kitzeln. Doch selbst wenn der Künstler diese Tugend respektiert, darf er sich nicht von jedem Verdacht rein gewaschen fühlen. Seine Auflehnung, seine Weigerung, seine Verwünschungen bleiben immer auf derselben Seite der Barriere: auf Seiten der Sprache der Mächtigen. Ein paar Worte, ein paar Sätze mögen entkommen. Aber der Rest? Ein langes Palimpsest, eine elegante, distanzierte Ausflucht. Und manchmal etwas Humor, der nicht die Höflichkeit der Verzweiflung, sondern die Hoffnungslosigkeit der Unvollkommenen ist, der Strand, auf dem die tosende Strömung der Ungerechtigkeit sie zurücklässt.
Warum soll man dann schreiben? Der Schriftsteller besitzt schon seit einiger Zeit nicht mehr die Überheblichkeit zu glauben, dass er die Welt verändert und mit seinen Kurzgeschichten, seinen Romanen ein besseres Lebensmodell schafft. Heute will er nur noch Zeuge sein. Sehen Sie diesen anderen Baum im Wald der Paradoxe. Der Schriftsteller will Zeuge sein, dabei ist er die meiste Zeit nur ein einfacher Voyeur.
Es kommt vor, dass der Künstler zum Zeugen wird: Dante in La Divina Commedia, Shakespeare in The Tempest – und Aimé Césaire in der herrlichen Neufassung dieses Stücks mit dem Titel Une Tempête, in dem Caliban auf einem Pulverfass sitzt und droht, seine verhassten Herren mit sich in den Tod zu reißen. Manchmal ist er sogar ein nicht zurückweisbarer Zeuge wie Euclides da Cunha im Os Sertões oder wie Primo Levi. Das Absurde der Welt kommt in Der Prozess (oder in den Filmen von Charlie Chaplin) zum Ausdruck, ihre Unvollkommenheit in Colettes La Naissance du jour, ihre bizarre Seite in der irischen Ballade, die James Joyce in Finnegans Wake in Szene gesetzt hat. Ihre Schönheit erstrahlt in unwiderstehlichem Glanz in Peter Matthiessens Reisebericht The Snow Leopard oder in Aldo Leopolds A Sand County Almanac. Ihre Bosheit in William Faulkners Sanctuary oder in Lao Shes Erster Schnee. Ihre kindliche Empfindlichkeit in Dagermans Ormen (Die Schlange).
Der Schriftsteller legt immer dann das zuverlässigste Zeugnis ab, wenn er es ungewollt oder nur widerwillig tut. Das Paradox besteht darin, dass er das, wovon er Zeugnis ablegt, nicht gesehen und nicht einmal erfunden hat. Die Verbitterung und manchmal die Verzweiflung rühren daher, dass er bei der Anklagerede nicht zugegen war. Tolstoi hält uns das Leid vor Augen, das Napoleons Armee in Russland angerichtet hat, und dennoch hat sich am Lauf der Geschichte nichts geändert. Claire de Duras schreibt Ourika, Harriet Beecher Stowe Uncle Tom’s Cabin, aber es sind nicht Schriftsteller, sondern die Sklavenvölker selbst, die ihr Schicksal verändern. Sie lehnen sich auf, stellen in Brasilien, in Guyana und auf den Antillen den Widerstand der Marron-Sklaven der Ungerechtigkeit entgegen und gründen in Haiti die erste schwarze Republik.
Der Schriftsteller würde vor allem gern handeln. Handeln und nicht Zeugnis ablegen. Schreiben, sich ausmalen, träumen, damit seine Worte, seine Erfindungen und seine Träume einen Einfluss auf die Wirklichkeit haben, die Hirne und die Herzen verändern und eine bessere Welt herbeiführen. Und doch flüstert ihm genau in diesem Augenblick eine Stimme ins Ohr, dass das nicht möglich ist, dass Worte nur Worte sind, die von der Gesellschaft weggefegt werden, und dass Träume nur Schimären sind. Was verleiht ihm das Recht zu glauben, er verstände es besser? Ist es wirklich die Aufgabe des Schriftstellers, Auswege zu suchen? Befindet er sich nicht in der Lage des Gemeindeausrufers in dem Theaterstück Knock ou Le Triomphe de la médecine, der ein Erdbeben zu verhindern sucht? Wie sollte ein Schriftsteller handeln, wo er sich doch nur darauf versteht, sich zu erinnern?
Die Einsamkeit wird ihm zum Schicksal. Sie ist es immer gewesen. Als Kind war er ein empfindliches, besorgtes, außerordentlich rezeptives Wesen, jenes Mädchen, das Colette beschreibt, das nur hilflos zusehen kann, wie sich die Eltern heftig streiten, wobei seine großen schwarzen Augen von schmerzhafter Aufmerksamkeit geweitet sind. Die Einsamkeit ist dem Schriftsteller eine liebevolle Begleiterin, in ihrer Gesellschaft findet er die Essenz des Glücks. Es ist ein widersprüchliches Glück, eine Mischung aus Schmerz und Genuss, ein lächerlicher Triumph, ein dumpfes, allgegenwärtiges Leiden wie eine Melodie, die einen unablässig verfolgt. Der Schriftsteller ist ein Mensch, der diese giftige, aber notwendige Pflanze am besten züchtet, die nur auf dem Boden seiner eigenen Unfähigkeit gedeiht. Er wollte eigentlich für alle und für alle Zeiten reden: und nun sitzt er in seinem Zimmer vor dem zu weißen Spiegel der leeren Seite, unter dem Lampenschirm, der ein gedämpftes Licht spendet. Oder vor dem zu grellen Bildschirm seines Computers und lauscht dem klickenden Geräusch seiner Finger auf den Tasten. Das ist sein Wald. Der Schriftsteller kennt jeden Pfad darin nur zu gut. Und wenn manchmal etwas daraus entflieht, wie etwa ein Vogel, den ein Hund im Morgengrauen aufscheucht, dann blickt er verblüfft auf – es war ein Zufall, es ist gegen seinen Willen geschehen.
Aber ich möchte mich nicht auf eine negative Haltung beschränken. Die Literatur – und darauf wollte ich hinaus – ist kein archaisches Relikt, das auf logische Weise durch die Künste der audiovisuellen Medien und besonders den Film ersetzt wird. Sie ist ein komplexer, schwieriger Weg, den ich aber heutzutage für noch notwendiger halte als zur Zeit von Byron oder Victor Hugo.
Es gibt zwei Gründe für diese Notwendigkeit:
Zunächst einmal, weil die Literatur mit Hilfe von Sprache geschaffen wird. Das ist der wörtliche Sinn: von lateinisch littera „Buchstabe, Schrift“ abgeleitet, also das, was geschrieben ist. Das französische Wort roman bezeichnete die Prosaschriften, die zum ersten Mal seit dem Mittelalter in der neuen Sprache geschrieben waren, die jeder benutzte, die romanische Sprache. Der Begriff „Novelle“ enthält ebenfalls diesen Gedanken der Neuartigkeit. Etwa um die gleiche Zeit hat man in Frankreich damit aufgehört, das Wort rimeur zu benutzen, das man mit „Reimeschmied“ übersetzen könnte, und beginnt statt dessen von Poesie und Poeten zu sprechen – abgeleitet von dem griechischen Verb poiein „machen, verfertigen, schöpferisch tätig sein“. Der Schriftsteller, der Poet, der Romancier sind Schöpfer. Das soll nicht etwa heißen, dass sie die Sprache erfinden, sondern dass sie die Sprache benutzen, um damit Schönheit, Gedanken und Bilder zu schaffen. Deshalb kann man nicht auf sie verzichten. Die Sprache ist die hervorragendste Erfindung der Menschheit, sie geht allem voraus, hat an allem teil. Ohne die Sprache gäbe es keine Wissenschaft, keine Technik, keine Gesetze, keine Kunst und keine Liebe. Aber diese Erfindung wird ohne den Beitrag der Sprecher zu etwas Virtuellem. Sie kann verkümmern, verarmen, verschwinden. Die Schriftsteller sind in gewissem Maße deren Hüter. Wenn sie ihre Romane, ihre Gedichte, ihre Theaterstücke schreiben, erhalten sie die Sprache am Leben. Sie benutzen nicht Worte, sondern stellen sich im Gegenteil in den Dienst der Sprache. Sie feiern sie, feilen an ihr, verändern sie, weil die Sprache mit ihnen und durch sie lebt und die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit begleitet.
Als im letzten Jahrhundert die rassistischen Theorien entstanden sind, hat man die fundamentalen Unterschiede zwischen den Kulturen heraufbeschworen. In einer absurden Form von Hierarchie hat man den wirtschaftlichen Erfolg der Kolonialmächte mit ihrer angeblichen kulturellen Überlegenheit gleichgesetzt. Diese Theorien tauchen ab und zu wie ein ungesunder Fieberanfall wieder auf, um den Neokolonialismus oder den Imperialismus zu rechtfertigen. Manche Völker seien zurückgeblieben und hätten aufgrund ihres wirtschaftlichen Rückstands oder ihres archaischen technischen Entwicklungsstands kein Anrecht auf Anerkennung, kein Mitspracherecht. Aber ist man denn gewahr geworden, dass alle Völker der Welt, egal wo sie sich befinden und welches ihr Entwicklungsstadium sein mag, Sprache benutzen? Und jede dieser Sprachen ist ein gleichermaßen komplexes, logisch gestaltetes, analytisches Ganzes, das es erlaubt, die Welt auszudrücken – fähig, Wissenschaft zu entwickeln oder Mythen zu erfinden.
Nachdem ich die Existenz dieses zweideutigen, ein wenig archaischen Wesens verteidigt habe, das der Schriftsteller ist, möchte ich den zweiten Grund für die Existenz der Literatur nennen, der mehr mit den schönen Berufen der Verlagsbranche zu tun hat.
Man spricht heute viel von Globalisierung. Man vergisst dabei, dass das Phänomen in Europa schon während der Renaissance mit dem Beginn der Kolonialisierung begonnen hat. Die Globalisierung ist als solches nichts Schlechtes. Die Kommunikation erlaubt schnellere Fortschritte in der Medizin oder in der Wissenschaft. Vielleicht macht die schnelle Verbreitung von Nachrichten es schwieriger, dass Konflikte ausbrechen. Wenn es damals schon das Internet gegeben hätte, kann es sein, dass Hitler es nicht geschafft hätte, seine kriminelle Verschwörung anzuzetteln – er hätte sich damit vielleicht zu lächerlich gemacht.
Wir leben, wie es scheint, im Zeitalter des Internets und der virtuellen Kommunikation. Das ist gut so, aber was nützen diese erstaunlichen Erfindungen, wenn darüber der Unterricht der Schriftsprache und die Bücher vernachlässigt werden? Die Mehrzahl der Menschheit mit Flüssigkristallbildschirmen auszustatten, ist eine Utopie. Sind wir daher nicht dabei, eine neue Elite zu schaffen und eine neue Grenzlinie zu ziehen, die die Welt einteilt in jene, die Zugang zur Kommunikation und zum Wissen haben und jene, die davon ausgeschlossen bleiben? Große Völker, große Zivilisationen sind verschwunden, weil sie das nicht begriffen hatten. Es gibt zwar noch einige große Kulturen, die als Minoritäten bezeichnet werden, und die dank der oralen Übermittlung ihres Wissens und ihrer Mythen bis zum heutigen Tag überlebt haben. Es ist unerlässlich und durchaus positiv, den Beitrag dieser Kulturen anzuerkennen. Aber wir leben nicht mehr, ob wir es wollen oder nicht, im Zeitalter der Mythen, auch wenn wir das Zeitalter des Realen noch nicht erreicht haben. Man kann nicht die Achtung vor dem Anderen und die Gleichheit Aller zum Prinzip erheben, ohne jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, die Schrift zu erlernen.
Heute, nach der Dekolonisation, ist die Literatur eines der Mittel für die Männer und Frauen unserer Epoche, ihre Identität auszudrücken, ihr Mitspracherecht zu fordern und sich in ihrer Vielfalt Gehör zu verschaffen. Ohne ihre Stimmen, ohne ihren Aufruf würden wir in einer stummen Welt leben.
Die Kultur auf weltweiter Ebene geht uns alle an. Aber sie hängt vor allem von den Lesern ab, genauer gesagt von den Verlegern. Natürlich ist es ungerecht, dass ein Indianer aus dem Norden Kanadas in der Sprache der Eroberer – also auf Französisch oder auf Englisch – schreiben muss, um gehört werden zu können. Selbstverständlich ist es illusorisch zu glauben, dass sich die kreolische Sprache der Insel Mauritius oder der Antillen ebenso leicht Gehör verschaffen könnte wie die fünf oder sechs Sprachen, die heute die Medien ausschließlich beherrschen. Aber wenn die Welt sie über den Weg der Übersetzung hören kann, entsteht dadurch eine neue Situation, die zu Hoffnung berechtigt. Die Kultur ist, wie ich schon sagte, ein gemeinsames Gut der gesamten Menschheit. Aber damit das wirklich zum Tragen kommt, müsste jeder über dieselben Mittel verfügen, um Zugang zur Kultur zu haben. Und dafür ist das Buch mit seinem archaischen Charakter das ideale Werkzeug. Es ist praktisch, handlich und relativ billig. Es erfordert keinen hohen technischen Aufwand und kann in jedem Klima aufbewahrt werden. Sein einziger Nachteil – und hier wende ich mich besonders an die Verleger – liegt darin, dass es noch in vielen Ländern nur schwer zugänglich ist. Auf Mauritius entspricht der Preis eines Romans oder eines Gedichtbands einem großen Teil des Budgets einer Familie. In Afrika, in Südostasien, in Mexiko, in Ozeanien sind Bücher noch immer ein unerreichbarer Luxus. Dagegen gibt es mehrere Mittel. Die Koedition mit Verlagen der Entwicklungsländer, die Schaffung eines Fonds für Leihbibliotheken oder Bücherbusse und ganz allgemein eine größere Aufmerksamkeit für die Belange und die Manuskripte in den so genannten Minderheitssprachen – deren Sprecher zahlenmäßig manchmal durchaus mehrheitlich sind – würden der Literatur erlauben, weiterhin jenes wunderbare Mittel zu bleiben, sich selbst zu erkennen, den Anderen zu entdecken und das Konzert der Menschheit mit all dem Reichtum seiner Themen und Modulationen zu hören.
Es ist mir ein Anliegen, noch einmal auf den Wald zu sprechen zu kommen. Deshalb habe ich vermutlich diesen Satz von Stig Dagerman noch so genau in Erinnerung, deshalb möchte ich ihn immer wieder lesen und mich von ihm durchdringen lassen. Er hat etwas Verzweifeltes in sich und zugleich etwas Frohlockendes, denn in der Bitterkeit findet sich jene Wahrheit, die jeder sucht. Als Kind habe ich von diesem Wald geträumt. Er jagte mir Angst ein und zog mich zugleich an – in nehme an, dass der Däumling oder Hänsel und Gretel die gleiche Erregung empfunden haben, als der Wald sich mit all seinen Gefahren und all seinen Wundern hinter ihnen schloss. Der Wald ist eine Welt ohne Anhaltspunkte. Die dicht belaubten Bäume, die Dunkelheit, die dort herrscht, können einen die Orientierung verlieren lassen. Man könnte das gleiche von der Wüste oder vom hohen Meer sagen, wenn jede Düne, jeder Hügel vor den Augen verschwindet, um einen anderen Hügel oder eine andere Welle hervortreten zu lassen, die völlig identisch ist. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich gespürt habe, was Literatur vermag – in Jack Londons The Call of the Wild spürt einer der Protagonisten, der sich im Schnee verirrt hat, wie die Kälte ihn immer mehr überwältigt, während die Wölfe den Kreis immer enger um ihn ziehen. Er betrachtet seine schon starre Hand und bemüht sich, jeden einzelnen Finger nacheinander zu bewegen. Diese Entdeckung hatte für mich als Kind etwas Magisches. Das nennt man, sich seiner selbst bewusst zu werden.
Ich verdanke dem Wald eine meiner stärksten literarischen Gemütsbewegungen als Erwachsener. Das hat sich vor gut dreißig Jahren in einer Region Zentralamerikas abgespielt, die den Namen Tapón del Darién trägt, das Darien Gap, weil damals (und ich glaube, dass sich die Situation nicht geändert hat) die Panamericana, die Nord- und Südamerika von Alaska bis zur Spitze von Feuerland verbinden sollte, unterbrochen war. Der Isthmus von Panama ist in dieser Gegend von einem äußerst dichten Regenwald bewachsen, in dem man sich nur mit einer Piroge auf den Flussläufen fortbewegen kann. Dieser Wald wird von Indianern bewohnt, die sich in zwei Gruppen teilen, die Emberá und die Wounaan, die beide der Ge-Pamé-Karib-Sprachfamilie angehören. Ich war durch Zufall dorthin gekommen und war sogleich fasziniert von diesem Volk, so dass ich mehrere lange Aufenthalte bei ihnen verbracht habe, insgesamt fast drei Jahre. In dieser ganzen Zeit habe ich nichts anderes getan, als auf gut Glück von Haus zu Haus zu gehen – denn dieses Volk hatte sich damals geweigert, sich in Dörfern zusammenzuschließen – und zu lernen, in einem mir bis dahin völlig unbekannten Rhythmus zu leben. Wie alle richtigen Wälder, war dieser Wald besonders feindlich. Ich musste die ganze Palette der Gefahren und auch der Überlebensmöglichkeiten erlernen. Ich muss sagen, dass die Emberá insgesamt sehr viel Geduld mit mir gezeigt haben. Meine Ungeschicklichkeit brachte sie zum Lachen, und ich glaube, dass ich ihnen in gewisser Weise ebenso viel Zerstreuung geboten habe, wie sie mich Weisheit gelehrt haben. Ich habe dort nicht viel geschrieben. Der Wald ist dafür nicht die ideale Umgebung. Das Papier ist ständig feucht, und die Kugelschreiber trocknen von der Hitze aus. Alles, was elektrisch betrieben wird, hat keine lange Lebensdauer. Ich bin dort mit der Überzeugung hingegangen, dass Schreiben ein Privileg ist und dass mir das für immer bleiben würde, um mit den Problemen des Daseins fertig zu werden. Eine Art Schutzschild oder eine virtuelle Fensterscheibe, die ich hochkurbeln konnte, wann immer es mir beliebte, um mich vor Unwettern zu schützen.
Nachdem ich das System des Urkommunismus kennen gelernt hatte, das die Indianer praktizieren, ihren tiefen Widerwillen gegen jede Autorität und ihre Tendenz zu einer natürlichen Form von Anarchie, hatte ich angenommen, dass es im Regenwald keine Kunst als individuellen Ausdruck geben könne. Im Übrigen gab es bei diesen Menschen nichts, das dem gleicht, was man in unserer Konsumgesellschaft Kunst nennt. Statt Bilder zu malen, bemalten diese Männer und Frauen ihren Körper und hatten ganz allgemein eine Abneigung dagegen, etwas Dauerhaftes herzustellen. Dann bekam ich Zugang zu den Mythen. Wenn man in unserer Welt gedruckter Bücher von Mythen spricht, scheint man von etwas in sehr großer Ferne zu sprechen, entweder zeitlich oder räumlich. Auch ich habe an diese Entfernung geglaubt. Und plötzlich kamen die Mythen in regelmäßigen Abständen auf mich zu, fast jede Nacht. Neben einem Holzfeuer, das in den Häusern zwischen drei Steinen auf dem Boden entfacht wurde, umschwirrt von Mücken und Nachtfaltern, brachte die Stimme der Erzähler oder Erzählerinnen diese Geschichten, diese Legenden, diese Berichte in Bewegung, so als sprächen sie über die alltägliche Wirklichkeit. Der Erzähler sang mit schriller Stimme, schlug sich dabei auf die Brust und ahmte mit dem Gesicht pantomimisch den Ausdruck, die Leidenschaften oder die Sorgen seiner Gestalten nach. Das hätte durchaus ein Roman und kein Mythos sein können. Aber eines Abends kam eine junge Frau. Ihr Name war Elvira. Elvira war im ganzen Waldgebiet der Emberá für ihre Erzählkunst bekannt. Sie war eine Abenteurerin, lebte ohne Mann und ohne Kinder – es wurde erzählt, sie trinke gern und prostituiere sich ab und zu, aber ich glaube kein Wort davon – und ging von Haus zu Haus, um für eine Mahlzeit, eine Flasche Alkohol oder manchmal etwas Geld zu singen. Auch wenn ich nur auf dem Weg der Übersetzung Zugang zu ihren Geschichten hatte – die Sprache der Emberá besitzt eine literarische Version, die sehr viel komplexer ist als die Alltagssprache – habe ich sofort erfasst, dass sie eine große Künstlerin war, im besten Sinne des Wortes. Das Timbre ihrer Stimme, der Rhythmus ihrer Hände, die auf die schweren Ketten aus Silbermünzen auf ihrer Brust schlugen, und vor allem die besessene Miene, die ihr Gesicht und ihren Blick erleuchtete, ihre gezügelte, rhythmisch hervorgehobenen Erregung hielt alle Anwesenden in Atem. Den traditionellen Mythen – die Entdeckung des Tabaks, die Zwillinge aus den Anfängen, die Geschichten von Göttern und Menschen aus uralten Zeiten – fügte sie ihre eigenen Geschichten hinzu, die ihres ruhelosen Lebens, ihre Lieben, die Untreue und das Leiden, die großen Freuden der körperlichen Liebe, das Brennen der Eifersucht, die Angst vor Alter und Tod. Sie war die Dichtung in Aktion, das antike Theater und zugleich der zeitgenössische Roman, wie er moderner nicht sein konnte. Sie war all das mit Feuereifer und Gewalt, sie erfand in der Finsternis des Waldes, umgeben vom Surren der Insekten, vom Lärm der Kröten, vom Flattern der Fledermäuse, ein Gefühl, das man nicht anders nennen kann als Schönheit. So als verkörpere sie in ihrem Gesang die wahre Macht der Natur, und das größte Paradox bestand wohl darin, dass ausgerechnet diese Abgeschiedenheit, dieser Wald, der von der exklusiven Atmosphäre der literarischen Welt nicht weiter hätte entfernt sein können, der Ort war, an dem sich die Kunst mit außergewöhnlicher Kraft und Authentizität ausdrückte.
Anschließend habe ich dieses Land wieder verlassen und habe weder Elvira noch sonst einen der Erzähler aus den Wäldern des Darién je wieder gesehen. Aber davon ist mir sehr viel mehr als nur eine nostalgische Erinnerung zurückgeblieben, nämlich die Gewissheit, dass die Literatur existiert, trotz der zerstörenden Kraft der Konventionen und der Kompromisse, trotz der Unfähigkeit der Schriftsteller, die Welt zu verändern. Etwas Großes und Starkes, das sie übersteigt, sie manchmal beseelt und sie über sich hinauswachsen lässt und ihnen die Eintracht mit der Natur wiedergibt. Etwas Neues und zugleich Uraltes, nicht greifbar wie der Wind, ätherisch wie die Wolken, unendlich wie das Meer. Dieses Etwas, das zum Beispiel in der Dichtung von Jalla eddine er Rûmi oder in der visionären Tektonik von Emanuel Swedenborg vibriert. Das Erschauern, das einen beim Lesen der schönsten Texte der Menschheit überkommt, wie etwa in der Rede, die Stealth, der Häuptling der Lumni-Indianer, gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts an den Präsidenten der Vereinigten Staaten gerichtet hat, um ihm Land zu schenken: „Vielleicht sind wir ja Brüder…“
Etwas Einfaches, Wahres, das nur in der Sprache existiert. Eine Haltung, manchmal eine List, ein rauher Tanz oder lange Momente des Schweigens. Die Sprache des Spotts, die Einwürfe, die Verwünschungen und sogleich darauf die Sprache des Paradieses.
An Elvira möchte ich diese Lobrede richten – ihr widme ich diesen Preis, den mir die Schwedische Akademie heute verleiht. Ihr und all den Schriftstellern, die mich in meinem Leben begleitet haben – oder gegen die ich mich manchmal gerichtet habe. Den Afrikanern Wole Soyinka, Chinua Achebe, Ahmadou Kourouma, Mongo Beti, Cry the Beloved Country von Alan Paton, Chaka von Tomas Mofolo. Dem großen mauritischen Schriftsteller Malcolm de Chazal, dem Autor u. a. von Judas. Dem hindisprachigen mauritischen Schriftsteller Abhimanyu Unnuth für seinen Roman Lal passina (Sweating Blood), der urdusprachigen Schriftstellerin Hyder Quratulain für das Epos Ag ka Darya (River of Fire). Dem rebellischen réunionesischen Maloya-Sänger Danyèl Waro, der polynesischen Dichterin Dewé Gorodé, die der Kolonialmacht noch im Gefängnis getrotzt hat, Abdourahman Waberi, dem Rebellen. Juan Rulfo für Pedro Páramo und die Kurzgeschichten El llano en llamas und für die einfachen, ergreifenden Fotos, die er auf dem Land in Mexiko gemacht hat. John Reed für Insurgent Mexico, Jean Meyer, weil er die Botschaft von Aurelio Acevedo und den aufständischen Cristeros aus Zentralmexiko weiter getragen hat. Luis González, dem Autor von Peublo in vilo. John Nichols, der über die harten Lebensbedingungen in The Milagro Beanfield War geschrieben hat, Henry Roth, meinem Nachbarn auf der New York Avenue in Albuquerque (New Mexico) für Call it Sleep. Jean-Paul Sartre für die zurückgehaltenen Tränen in seinem Stück Morts sans sépulture. Wilfred Owen, dem Dichter, der 1918 am Ufer der Marne gefallen ist. Jerome D. Salinger, weil es ihm gelungen ist, uns in die Haut eines vierzehnjährigen Jungen namens Holden Caufield schlüpfen zu lassen. Den Schriftstellern der ersten Nationen Amerikas, dem Sioux Sherman Alexie, dem Navajo Scott Momaday für The Names. Rita Mestokosho, der Innu-Dichterin aus Mingan (in der Provinz Québec), die Bäume und Tiere sprechen lässt. José Maria Arguedas, Octavio Paz, Miguel Angel Asturias. Den Dichtern der Oasen Walata und Chinguetti. Den phantasievollen Autoren Alphonse Allais und Raymond Queneau. Georges Perec für Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour? Den Antillanern Edouard Glissant und Patrick Chamoiseau, dem Haitianer René Depestre, André Schwarz-Bart für Le Dernier des justes. Dem mexikanischen Dichter Homero Aridjis, der uns das Leben mit den Augen einer Lederschildkröte sehen lässt und von den orangefarbenen Monarchfaltern erzählt, die sich in Strömen durch die Straßen seines Dorfes Contepec ergießen. Vénus Koury Ghata, die vom Libanon spricht, als wäre er ein tragischer, unbesiegbarer Liebhaber. Khalil Jibran. Rimbaud. Emile Nelligan. Réjean Ducharme, fürs Leben.
Dem unbekannten Kind, dem ich eines Tages am Ufer des Tuira-Flusses im Regenwald des Darién begegnet bin. Es saß nachts auf dem Bretterboden eines kleinen Ladens und las im Licht einer Petroleumlampe ein Buch und schrieb vornüber gebeugt, ohne auf seine Umgebung zu achten, ohne sich von der unbequemen Situation, dem Lärm, den lästigen Nachbarn und dem aggressiven Treiben stören zu lassen, das sich in nächster Nähe abspielte. Ich spreche nicht zufällig von diesem Kind, das im Schneidersitz auf dem Bretterboden des kleinen Ladens sitzt und ganz allein im flackernden Licht der Lampe liest. Es gleicht wie ein Bruder dem anderen Kind, von dem ich zu Beginn gesprochen habe und das sich in den düsteren Jahren der Nachkriegszeit bemüht hat, mit einem Zimmermannsstift Worte auf die Rückseite der Lebensmittelkarten zu schreiben. Es ruft uns die beiden großen Notwendigkeiten der menschlichen Geschichte in Erinnerung, auf die wir leider noch lange keine befriedigende Antwort gegeben haben: die Ausmerzung des Hungers und die Alphabetisierung.
In seiner zutiefst pessimistischen Feststellung über das grundlegende Paradox des Schriftstellers, und zwar seine Unzufriedenheit darüber, dass er sich nicht an jene wenden kann, die – im wörtlichen Sinne – Hunger leiden und nach Wissen dürsten, bringt Stig Dagerman eine fundamentale Wahrheit zur Sprache. Die Alphabetisierung und der Kampf gegen den Hunger sind eng miteinander verbunden, hängen voneinander ab. Der Erfolg des einen ist ohne den Erfolg des anderen unmöglich. Beide verlangen heute von uns, dass wir handeln. Damit im dritten Jahrtausend, das vor kurzem begonnen hat, auf der Erde, die wir gemeinsam bewohnen, kein Kind, gleich welchen Geschlechts, welcher Sprache oder welcher Religion, dem Hunger oder der Unwissenheit überlassen wird und von dem Fest ausgeschlossen ist. Dieses Kind trägt die Zukunft unserer Menschenrasse in sich. Ihm gebührt die „königliche Macht“, wie der griechische Philosoph Heraklit vor langer Zeit geschrieben hat.
J.M.G. Le Clézio, Bretagne, 4. November 2008
Aus dem Französischen von Uli Wittmann
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 12 laureates' work and discoveries range from proteins' structures and machine learning to fighting for a world free of nuclear weapons.
See them all presented here.