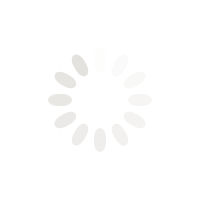Kazuo Ishiguro – Nobelvorlesung
English
English [pdf]
Swedish
Swedish [pdf]
French
French [pdf]
German
German [pdf]
Spanish
Spanish [pdf]
7. Dezember 2017
Mein napoleonischer Abend – und andere kleine Offenbarungen
Wären Sie mir im Herbst 1979 begegnet, hätten Sie vielleicht Mühe gehabt, mich einzuordnen, gesellschaftlich oder sogar ethnisch. Damals war ich 24. Meine Gesichtszüge wirkten wohl japanisch, doch im Unterschied zu den meisten Japanern, die man damals in Großbritannien zu sehen bekam, hatte ich schulterlanges Haar und einen hängenden Räuberschnurrbart. Der einzige identifizierbare Akzent war ein südenglischer, mit gelegentlichen Ausflügen in den coolen, aber damals schon altmodischen Hippiejargon. Wären wir miteinander ins Gespräch gekommen, hätten wir vielleicht über den Totalen Fußball der niederländischen Nationalelf geredet oder über das jüngste Album von Bob Dylan, vielleicht auch über mein soziales Jahr in London, in dem mich um Obdachlose gekümmert hatte. Hätten Sie die Rede auf Japan gebracht, mich nach der japanischen Kultur gefragt, hätten Sie vielleicht einen Anflug von Unwillen wahrgenommen, denn ich hätte Ihnen erklärt, dass ich nicht die geringste Ahnung hätte, weil ich seit neunzehn Jahren keinen Fuß mehr in das Land gesetzt hätte, nicht mal für einen Besuch in den Ferien.
Im Herbst 1979 war ich mit Rucksack, Gitarre und Reiseschreibmaschine nach Norfolk gekommen, genauer nach Buxton, ein kleines englisches Dorf mit einer alten Wassermühle und flachem Ackerland ringsum. Ich war hier, weil ich an der University of East Anglia zu einem einjährigen Graduiertenkurs in kreativem Schreiben angenommen worden war. Die Uni war zehn Meilen entfernt, in der Kathedralenstadt Norwich, ich hatte kein Auto und kam nicht anders hin als mit einem Bus, der genau dreimal am Tag fuhr, morgens, mittags und abends. Das war aber, wie ich bald feststellte, nicht weiter schlimm, denn man wurde selten öfter als zweimal wöchentlich an der Uni erwartet. Ich wohnte in einem kleinen Haus bei einem Mann in den Dreißigern, der kurz zuvor von seiner Frau verlassen worden war; bei ihm hatte ich ein Zimmer gemietet. Vielleicht war ihm das Haus zuwider, weil seine zerbrochenen Träume darin spukten, vielleicht wollte er mir auch nur aus dem Weg gehen – jedenfalls bekam ich ihn oft tagelang nicht zu Gesicht. Der Kontrast hätte kaum größer sein können; aus meinem hektischen Londoner Leben war ich in eine ganz ungewohnt stille Einsamkeit geraten, in der ich Schriftsteller werden sollte.
Tatsächlich war das Zimmerchen, in dem ich wohnte, der klassischen Dachkammer des Dichters nicht unähnlich. Die schrägen Wände hatten etwas Beklemmendes; wenn ich mich aber auf Zehenspitzen zu meinem einzigen Dachfenster reckte, hatte ich eine endlos weite Aussicht auf gepflügte Äcker. Es gab einen kleinen Tisch, dessen Platte mit meiner Schreibmaschine und einer Lampe fast vollständig ausgefüllt war. Statt eines Bettes hatte ich auf dem Boden ein großes Schaumstoffviereck, auf dem mir allnächtlich der Schweiß ausbrach, auch in den bitterkalten Norfolker Nächten.
In diesem Zimmer nahm ich mir noch einmal die beiden Kurzgeschichten vor, die ich im Sommer geschrieben hatte; ich wollte wissen, ob sie gut genug waren, um vor meinen neuen Kommilitonen zu bestehen. (Wir waren zu sechst, wusste ich inzwischen, und sollten uns alle zwei Wochen zusammensetzen.) An erzählender Prosa hatte ich bisher wenig Bemerkenswertes zu bieten; die Teilnahme am Kurs hatte ich mir mit einem Hörspiel verdient, das von der BBC abgelehnt worden war. Überhaupt hatten sich meine literarischen Ambitionen erst jüngst bemerkbar gemacht, denn etwa bis zu meinem zwanzigsten Jahr war ich entschlossen gewesen, Rockstar zu werden. Die beiden Geschichten, über denen ich jetzt brütete, waren aus einer Art Panik heraus entstanden, nachdem ich erfahren hatte, dass ich angenommen war. Die eine handelte von einem makabren Selbstmordpakt, die andere von Straßenkämpfen in Schottland, wo ich eine Zeitlang Sozialarbeiter gewesen war. Sie waren nicht besonders gut. Ich begann mit einer dritten Geschichte; sie handelte von einem Teenager, der seine Katze vergiftet, und spielte wie die beiden anderen im zeitgenössischen Großbritannien. Aber eines Abends, nach drei oder vier Wochen in meiner Kammer, schrieb ich auf einmal anders, mit einer unbekannten, drängenden Intensität, und zwar über Japan – über die Stadt, in der ich geboren bin, Nagasaki, während der letzten Tage des zweiten Weltkriegs.
Es überraschte mich selber, muss ich zugeben. Heute ist die herrschende Atmosphäre so, dass der aufstrebende Schriftsteller mit gemischtem kulturellem Erbe praktisch instinktiv seine “Wurzeln” zu erkunden sucht. Das war damals völlig anders. In Großbritannien dauerte es noch etliche Jahre, bis die “multikulturelle” Literatur regelrecht explodierte. Salman Rushdie war noch ein Unbekannter, der einen einzigen Roman veröffentlicht hatte, und der war schon vergriffen. Hätte man die führenden jungen britischen Schriftsteller der Zeit aufzählen sollen, hätte man vielleicht Margaret Drabble genannt; unter den älteren Iris Murdoch, Kingsley Amis, William Golding, Antony Burgess, John Fowles. Fremdsprachige Autoren wie Gabriel García Márquez, Milan Kundera, Borges wurden damals nur in Kleinstauflagen gelesen; selbst begeisterten Lesern sagten ihre Namen nichts.
Das war das herrschende literarische Klima, und angesichts dieser Lage wurde ich, als ich meine erste japanische Geschichte beendet und eigentlich sehr stark das Gefühl hatte, eine wichtige neue Richtung entdeckt zu haben, sofort vom Zweifel gepackt, ob ich mit dem, was ich als Aufbruch empfand, nicht einfach nur private Bedürfnisse auslebte; ob ich nicht lieber schnell zu “normaleren” Themen zurückkehren sollte. Es dauerte lang, bis ich mich überwinden konnte, die Geschichte herzuzeigen, und ich bin meinen Kommilitonen, meinen Tutoren, Malcolm Bradbury und Angela Carter, und dem Schriftsteller Paul Bailey, der damals für ein Jahr Writer-in-residence der Universität war, bis zum heutigen Tag zutiefst dankbar für ihre Reaktion, die nichts als Zuspruch und Ermutigung war. Wären sie weniger überzeugt gewesen, hätte ich wahrscheinlich nie wieder über Japan geschrieben. Aber nach dem Echo, das ich von ihnen bekam, kehrte ich in meine Kammer zurück und schrieb und schrieb. Den ganzen Winter 1979/80 und bis weit in den Frühling hinein sprach ich mit praktisch niemandem außer meinen fünf Mitstudenten, dem Besitzer des Dorfladens, bei dem ich die Frühstücksflocken und Lammnieren kaufte, von denen ich existierte, und meiner Freundin Lorna (heute meine Frau), die mich jedes zweite Wochenende besuchte. Ein ausgewogenes Leben war es nicht, aber nach vier oder fünf Monaten hatte ich die Hälfte meines ersten Romans fertig, A Pale View of Hills, der ebenfalls in Nagasaki spielt, in den Jahren der Regeneration nach dem Abwurf der Atombombe. Ich weiß noch, dass ich in dieser Phase mit ein paar Ideen für Kurzgeschichten spielte, die keinen Bezug zu Japan hatten, stellte aber jedes Mal fest, dass mein Interesse sehr schnell erlahmte.
Diese Monate waren insofern entscheidend für mich, als ich, hätte ich sie nicht erlebt, wahrscheinlich nie Schriftsteller geworden wäre. Seither habe ich oft zurückgeblickt und mich gefragt: Was ging damals in mir vor? Woher kam diese eigenartige Energie? Mein Fazit ist, dass es an diesem Punkt meines Lebens um einen notwendigen Akt des Bewahrens ging. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen.
*
Mit fünf Jahren, im April 1960, war ich mit meinen Eltern und meiner Schwester nach England gekommen, in die Stadt Guildford; sie liegt in Surrey, dreißig Meilen südlich von London, im Speckgürtel der Stadt. Mein Vater war Meeresforscher, der im Auftrag des britischen Staates hergekommen war. – Übrigens erfand er später eine Maschine, die heute zur Dauerausstellung des Science Museum in London gehört.
Die Fotos, die kurz nach unserer Ankunft entstanden, zeigen ein England, das es nicht mehr gibt. Männer tragen Wollpullover mit V-Ausschnitt und Krawatte, die Autos haben Trittbretter und das Reserverad hinten auf dem Kofferraum. Bis zu den Beatles, der sexuellen Revolution, den Studentenprotesten, der “Multikulturalität” war es nicht mehr weit, aber man kann sich kaum vorstellen, dass das England, in dem wir ankamen, auch nur das Geringste davon ahnte. Schon einem Franzosen oder Italiener zu begegnen war bemerkenswert – ein Japaner war eine Sensation.
Wir wohnten in einer aus zwölf Häusern bestehenden Sackgasse; gleich dahinter hörten die geteerten Straßen auf, und die Felder und Wiesen fingen an. Bis zum nächsten Bauernhof und dem Feldweg, auf dem morgens und abends die Kühe hintereinander her zur Weide und zurück in den Stall gingen, waren es keine fünf Minuten. Die Milch wurde mit einem Pferdefuhrwerk geliefert. Ein vertrauter Anblick aus meiner ersten Zeit in England, der mir noch sehr stark in Erinnerung ist, waren überfahrene Igel am Straßenrand: Diese reizenden nachtaktiven Stachelwesen, die damals auf dem Land so verbreitet waren, lagen morgens taufeucht und beinahe ordentlich neben der Straße, bis die Müllabfuhr sie mitnahm.
Unsere Nachbarn waren regelmäßige Kirchgänger, und wenn ich ihre Kinder zum Spielen besuchte, stellte ich fest, dass vor dem Essen gebetet wurde. Ich ging zur Sonntagsschule, und bald sang ich auch im Kirchenchor; mit zehn war ich der erste japanische Stimmführer im Knabenchor von Guildford. Ich besuchte die örtliche Grundschule, wo ich das einzige nichtenglische Kind war – womöglich in der gesamten Geschichte der Schule –, und als ich elf war, fuhr ich mit dem Zug zur Grammar School, dem Gymnasium in der Nachbarstadt. Mit mir im Waggon saßen jeden Morgen Scharen von Herren mit Melone und Nadelstreifen auf dem Weg nach London, ins Büro.
Bis dahin hatte ich die Manieren, die von englischen Bürgersöhnen jener Zeit erwartet wurden, gründlich gelernt. Wenn ich bei einem Freund zu Besuch war, wusste ich, dass ich strammzustehen hatte, sobald ein Erwachsener das Zimmer betrat, und dass man um Erlaubnis fragte, ehe man vom Tisch aufstand. Als einzigem ausländischem Jungen im Viertel hing mir eine gewisse lokale Berühmtheit an. Andere Kinder wussten, wer ich war, ohne dass wir uns je getroffen hatten. Auf der Straße oder im Geschäft sprachen mich manchmal vollkommen fremde Erwachsene mit Namen an.
Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue – und bedenken Sie bitte, dass der Weltkrieg, in dem die Japaner erbitterte Feinde gewesen waren, noch keine zwanzig Jahre vorbei war –, staune ich über die Offenheit und instinktive Herzlichkeit, mit der unsere Familie von der ganz normalen englischen Bevölkerung aufgenommen wurde. Meine bis zum heutigen Tag anhaltende Zuneigung, Achtung und Neugier gegenüber dieser Generation der Briten, die den Krieg überstanden und in der Nachkriegszeit einen bemerkenswerten neuen Sozialstaat aufgebaut hat, rührt sehr wesentlich von meinen persönlichen Erfahrungen in diesen Jahren her.
Doch währenddessen führte ich zu Hause mit meinen japanischen Eltern ein ganz anderes Leben. Zu Hause gab es andere Regeln, andere Erwartungen, eine andere Sprache. Ursprünglich hatten meine Eltern nur ein Jahr bleiben wollen, vielleicht zwei. Tatsächlich waren wir während unserer ersten elf Jahre in England in ständiger Aufbruchsstimmung – nächstes Jahr sind wir wieder in Japan, hieß es. So kam es, dass meine Eltern auf England immer wie Besucher blickten, nie wie Einwanderer. Die kuriosen Sitten der Einheimischen waren ihnen häufige Kommentare wert, und nie wären sie auf die Idee gekommen, sie etwa zu übernehmen. Auch galt lange als ausgemacht, dass ich zurückkehren und als Erwachsener in Japan leben würde, so dass erhebliche Anstrengungen unternommen wurden, um die japanische Seite meiner Erziehung nicht zu vernachlässigen. Jeden Monat kam ein Paket aus Japan mit den Comics, Zeitschriften und Schülertexten des vergangenen Monats, die ich alle gierig verschlang. Irgendwann in meinen Teenagerjahren wurden die Sendungen eingestellt – vielleicht nach dem Tod meines Großvaters –, doch die Erzählungen meiner Eltern von alten Freunden, von Verwandten, von Begebenheiten aus ihrem Leben in Japan waren ein ständiger Nachschub an Bildern und Eindrücken. Und schließlich hatte ich immer meinen eigenen Vorrat an Erinnerungen – überraschend viele und klare sogar: an meine Großeltern, meine Spielsachen, die ich zurückgelassen hatte, an das traditionelle japanische Haus, in dem wir gewohnt hatten (noch heute kann ich es im Geist Zimmer für Zimmer rekonstruieren), meinen Kindergarten, die Straßenbahnhaltestelle, an der wir aus- und einstiegen, den bösen Hund, der an der Brücke wohnte, den Stuhl beim Frisör, in dem die kleinen Jungen saßen: An der Ablage vor dem Spiegel war ein Lenkrad befestigt.
Mit anderen Worten, ich war als Kind und Jugendlicher, lang bevor ich auf die Idee kam, fiktionale Welten zu erdichten, eifrig beschäftigt, im Geist detailreich einen Ort zu konstruieren, der “Japan” hieß – einen Ort, der mir eine Art Heimat war, von dem ich ein Gefühl für meine Identität und mein Selbstvertrauen bezog. Dass ich während der ganzen Zeit kein einziges Mal leibhaftig in Japan war, ließ meine Vorstellung davon nur umso farbiger und persönlicher werden.
Daher mein Bedürfnis nach Bewahrung. Denn mit Mitte zwanzig wurde mir allmählich einiges klar – obwohl ich es damals nie in konkrete Worte fasste. Ich begann einzusehen, dass “mein” Japan vielleicht sehr wenig einem Land entsprach, in das ich mit einem Flugzeug reisen konnte; dass die Lebensweise, die meine Eltern heraufbeschworen und die ich von meiner frühen Kindheit in Erinnerung hatte, während der 60er und 70er Jahre weitgehend ausgestorben war; dass das Japan meiner Vorstellung womöglich immer nur ein emotionales Konstrukt gewesen war, wie es sich ein Kind aus Erinnerung, Fantasie und Spekulation zusammensetzt. Und vor allem wurde mir bewusst, dass dieses mein Japan, dieser kostbare Schatz, mit dem ich erwachsen geworden war, zusehends verblasste.
Dieses Gefühl, dass “mein” Japan einzigartig sei und zugleich überaus anfällig, ein Gebilde, das keiner Überprüfung von außen standhielte, muss damals in meiner Kammer in Norfolk mein Antrieb zum Schreiben gewesen sein, da bin ich heute sicher. Ich tat nichts anderes als die besonderen Farben jener Welt, ihre Sitten, Umgangsformen, ihre Würde und ihre Unzulänglichkeiten, alles, was ich mir jemals vorgestellt hatte, aufzuschreiben, ehe es für immer aus meinem Gedächtnis verschwand. Ich wollte mein Japan in einem Roman wiedererwecken und festhalten, wollte es retten, damit ich nachher auf ein Buch zeigen und sagen konnte: “Ja, das ist mein Japan, hier drin.”
*
Frühjahr 1983, dreieinhalb Jahre später. Lorna und ich lebten jetzt in London, in zwei Zimmern im obersten Stock eines hohen schmalen Hauses, das seinerseits auf einem Hügel an einem der höchstgelegenen Punkte der Stadt stand. Nicht weit von uns gab es einen Fernsehmast, und wenn wir Schallplatten hören wollten, drängten sich immer wieder Geisterstimmen in die Lautsprecher. In unserem Wohnzimmer gab es weder Sofa noch Sessel, aber zwei Matratzen mit Kissen auf dem Boden. Es gab auch einen großen Tisch, an dem ich tagsüber schrieb und der abends unser Esstisch war. Luxuriös war es nicht, aber wir wohnten gern hier. Im Jahr zuvor hatte ich meinen ersten Roman veröffentlicht, außerdem hatte ich ein Drehbuch für einen kurzen Film geschrieben, der bald im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden sollte.
Auf meinen ersten Roman war ich eine Zeitlang recht stolz gewesen, in diesem Frühjahr aber empfand ich eine bohrende Unzufriedenheit, die mich nicht mehr losließ. Das Problem war folgendes: Mein erster Roman und mein erstes TV-Drehbuch waren einander zu ähnlich. Nicht thematisch, aber in der Methode und im Stil. Je länger ich mir die Sache ansah, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass der Roman im Grunde ein Drehbuch sei – Dialog plus Regieanweisungen. Bis zu einem gewissen Grad war das in Ordnung, aber jetzt hatte ich den Wunsch, Literatur zu schreiben, die nur als Literatur funktionierte. Wozu einen Roman schreiben, wenn man beim Lesen mehr oder minder das gleiche Erlebnis hat wie beim Fernsehen? Wie sollte sich Literatur gegen die Macht von Film und Fernsehen durchsetzen, wenn sie nichts Einzigartiges, Unnachahmliches zu bieten hatte?
Um diese Zeit fing ich mir einen Virus ein und lag ein paar Tage im Bett. Als das Schlimmste überstanden war und ich nicht mehr ununterbrochen schlafen konnte, stellte ich fest, dass das schwere Ding in meinem Bett, das mir schon seit einer Weile auf die Nerven ging, in Wirklichkeit ein Exemplar des ersten Bandes von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit war. Nachdem das Buch schon mal da war, begann ich zu lesen. Mein immer noch fiebriger Zustand mag eine Rolle gespielt haben, auf jeden Fall war ich vollkommen gefesselt, zumal von der Einleitung und dem Abschnitt über Combray, die ich wieder und wieder las. Ganz abgesehen von der großen Schönheit dieser Passagen faszinierte mich, wie Proust es fertig brachte, eine Episode in die nächste übergehen zu lassen. Die Anordnung der Ereignisse und Szenen folgte weder den üblichen chronologischen Erwartungen noch einer linearen Handlung, vielmehr schienen tangentiale Gedankenassoziationen oder die Launen der Erinnerung den Text von einem Ereignis zum anderen voranzutreiben. Immer wieder fragte ich mich: Warum stehen diese zwei offenbar zusammenhanglosen Momente im Geist des Erzählers nebeneinander? Auf einmal erkannte ich einen Weg, um meinen zweiten Roman spannender, freier zu gestalten, eine Methode, mit der ich Vielfalt auf der geschriebenen Seite erzeugen und zugleich innere Bewegungen zeigen konnte, die keine Verfilmung je wiedergeben kann. Wenn es gelang, dachte ich, mich entlang von Assoziationen und auftauchenden Erinnerungen von einem Abschnitt zum nächsten zu bewegen, konnte ich vielleicht ähnlich vorgehen wie ein abstrakter Maler, der Form und Farbe auf der Leinwand anordnet. Ich konnte eine Szene, die sich zwei Tage früher ereignet hatte, neben eine zwanzig Jahre alte Begebenheit stellen und den Leser auffordern, die Beziehung zwischen beiden Ereignissen zu ermessen. Auf diese Weise konnte ich die ungezählten Schichten der Selbsttäuschung und Verdrängung andeuten, mit denen sich das Selbstbild und der Blick auf die eigene Vergangenheit gern zu umhüllen pflegen.
*
März 1988. Ich war 33 Jahre alt. Wir hatten jetzt ein Sofa, und auf dem lag ich und hörte Tom Waits. Im Jahr zuvor hatten Lorna und ich ein eigenes Haus erstanden, in einem nicht begehrten, aber sympathischen Teil Südlondons, und in diesem Haus hatte ich zum ersten Mal ein eigenes Arbeitszimmer. Es war klein und hatte keine Tür, aber ich war begeistert, dass ich meine Papiere ringsum verstreuen konnte und nicht jeden Abend alles aufräumen musste. Und in diesem Arbeitszimmer – glaube ich jedenfalls – hatte ich soeben meinen dritten Roman beendet. Es war der erste, der nicht in Japan spielte – die Arbeit an meinen ersten beiden Romanen hatte mein privates Japan weniger fragil gemacht. Tatsächlich schien mir das neue Buch, das The Remains of the Day heißen sollte, extrem englisch – wenn auch hoffentlich nicht in der Weise, in der viele britische Autoren der älteren Generation geschrieben hatten. Ich war sehr darauf bedacht gewesen, nicht einfach vorauszusetzen, dass meine Leser alle Engländer seien und eine muttersprachliche Vertrautheit mit englischen Nuancen und Besonderheiten besäßen, wie mir bei vielen meiner Vorgänger der Fall zu sein schien. Mittlerweile hatten Schriftsteller wie Salman Rushdie und V. S. Naipaul einer internationaleren, nach außen gewandten britischen Literatur den Weg geebnet, einer Literatur, die Großbritannien nicht selbstverständlich und automatisch in den Mittelpunkt stellte. Ihre Werke waren postkolonial im umfassendsten Sinn. Wie sie wollte ich “internationale” Literatur schreiben, die kulturelle und sprachliche Grenzen leicht überwinden konnte, auch wenn die Geschichte in einer anscheinend eigenartig englischen Welt spielte. Meine Version von England sollte eine sozusagen mythische sein, die, dachte ich, in der Fantasie zahlloser Menschen überall auf der Welt, auch wenn sie das reale England nie gesehen hatten, schemenhaft schon vorhanden war.
*
Die Geschichte, die ich kurz zuvor beendet hatte, handelt von einem englischen Butler, dem zu spät aufgeht, dass er sein Leben lang den falschen Werten nachgelaufen ist; dass er seine besten Jahre damit vertan hat, einem Nazisympathisanten zu dienen; dass er mit seiner Weigerung, moralische und politische Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, dieses Leben im wahrsten Sinn vergeudet hat. Und noch mehr: dass er sich in seinem Ehrgeiz, der perfekte Diener zu werden, untersagt hat, die eine Frau, die ihm wichtig ist, zu lieben oder von ihr geliebt zu werden.
Ich hatte mein Manuskript mehrfach gelesen und war eigentlich zufrieden. Dennoch blieb dieses bohrende Gefühl, dass etwas fehlte.
Dann lag ich, wie gesagt, eines Abends in unserem Haus auf dem Sofa und hörte Tom Waits. Und Tom Waits begann mit einem Lied, das “Ruby’s Arms” heißt. Vielleicht kennen es einige von Ihnen. (Ich habe sogar kurz überlegt, es Ihnen an dieser Stelle vorzusingen, aber die Idee dann wieder verworfen.) Es ist eine Ballade über einen Mann, vielleicht einen Soldaten, der seine Geliebte schlafend im Bett zurücklässt. Es ist frühmorgens, er geht die Straße entlang, steigt in einen Zug. Bis dahin nichts Ungewöhnliches. Aber vorgetragen wird dieses Lied mit der Stimme eines ruppigen amerikanischen Wanderarbeiters, dem es völlig fremd ist, tiefere Gefühle zu offenbaren. Und es kommt ein Moment, etwa in der Mitte des Songs, in dem der Sänger sagt, dass ihm dieser Abschied das Herz bricht. Dieser Moment ist so ergreifend, dass es fast unerträglich ist; schuld daran ist die Spannung zwischen dem Gefühl und dem ungeheuren Widerstand, der offensichtlich überwunden werden musste, um es einzugestehen. Tom Waits singt die Zeile mit kathartischer Großartigkeit; man spürt sehr deutlich, wie der lebenslange Stoizismus eines hartgesottenen Burschen angesichts überwältigender Traurigkeit in sich zusammenfällt.
Ich hörte Tom Waits zu und wusste auf einmal, was ich noch zu tun hatte. Ohne nachzudenken, hatte ich irgendwann entschieden, dass mein englischer Butler seine emotionale Abwehr beibehalten, dass er sich dahinter verstecken würde, vor sich und den Lesern, bis ganz zuletzt. Jetzt war mir klar, dass ich meine Entscheidung rückgängig machen musste. Nur für einen Moment, kurz vor dem Ende der Geschichte, einen Moment, den es sorgfältig zu wählen galt, musste ich seine Panzerung reißen lassen. Und unter dem Riss musste eine grenzenlose, tragische Sehnsucht sichtbar werden.
An dieser Stelle sei gesagt, dass mir die Stimmen von Sängern, Sängerinnen schon mehrmals die Augen geöffnet haben – weniger durch den gesungenen Text als durch die Art ihres Vortrags. Ich teile Ihnen nichts Neues mit, wenn ich hier sage, dass eine menschliche Stimme in der Lage ist, ein unermesslich komplexes Zusammenspiel von Gefühlen auszudrücken. Im Lauf der Jahre haben Künstler wie, um nur einige zu nennen, Bob Dylan, Nina Simone, Emmylou Harris, Ray Charles, Bruce Springsteen, Gillian Welch und meine Freundin und Mitarbeiterin Stacey Kent ganz bestimmte Aspekte meiner Arbeit beeinflusst; das geschah, wenn ich etwas Besonderes in ihren Stimmen wahrnahm und mir mit einem Schlag klar war: “Das ist es. Genau das muss ich in dieser Szene einfangen Etwas, das dem sehr nahe kommt.” Oft ist es ein Gefühl, das ich nicht recht in Worte fassen kann, aber in der singenden Stimme ist es zu spüren, und dann weiß ich, wohin der Weg geht.
*
Im Oktober 1999 lud mich der Schriftsteller Christoph Heubner im Namen des Internationalen Auschwitz-Komitees zu einem mehrtägigen Besuch des ehemaligen KZ ein. Untergebracht war ich in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte auf halbem Weg zwischen dem Stammlager Auschwitz und dem drei Kilometer weiter errichteten Vernichtungslager Birkenau. Ich wurde über das Gelände geführt und traf, informell, mit drei Überlebenden zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ich, zumindest geografisch, dem Kern der dunklen Kraft nahegekommen war, in deren Schatten meine Generation aufgewachsen war. In Birkenau stand ich an einem nassen Nachmittag vor den Ruinen der Gaskammern – seltsam vernachlässigt und dem Verfall preisgegeben: mehr oder minder in dem Zustand, in dem die Deutschen sie nach der Sprengung und ihrer Flucht vor der Roten Armee zurückgelassen hatten. Ich sah feuchte, zerbrochene Steinplatten, die dem rauen polnischen Klima ausgesetzt sind und Jahr für Jahr mehr zerfallen. Meine Gastgeber schilderten mir ihr Dilemma: Sollen die Überreste geschützt werden? Soll man Plexiglaskuppeln darüber errichten, um sie für die nachfolgenden Generationen zu erhalten? Oder soll man sie der natürlichen Verrottung überlassen, bis nichts mehr übrig ist? Das scheint mir eine bezeichnende Metapher für ein größeres Dilemma: Wie soll man überhaupt mit solchen Erinnerungen umgehen? Machen Glaskuppeln aus Zeugen des Bösen und des Leidens zahme Ausstellungsstücke? Welche Erinnerungen sollen wir wachhalten? Wann ist es besser zu vergessen und weiterzuleben?
Ich war 44 Jahre alt. Für mich hatte der zweiten Weltkrieg mit seinen Gräueln und seinen Siegen immer in die Generation meiner Eltern gehört. Und jetzt war mir auf einmal bewusst geworden, dass viele Zeitzeugen ja bald nicht mehr am Leben wären. Was dann? Müsste meine Generation die Last des Erinnerns übernehmen? Wir hatten den Krieg nicht erlebt, aber wir waren von Eltern aufgezogen worden, deren Leben von den Kriegsjahren untilgbar geprägt war. Hatte ich, als Geschichtenerzähler, der an die Öffentlichkeit tritt, jetzt eine Pflicht, die ich bisher nicht zur Kenntnis genommen hatte? Hatte ich die Pflicht, die Erinnerungen der älteren Generation und die Lektionen daraus der nächsten Generation weiterzugeben, so gut ich es konnte?
Nicht lang danach hielt ich einen Vortrag in Tokio, und im Publikum meldete sich eine Zuhörerin mit einer Frage, die häufig gestellt wird: woran ich denn als Nächstes arbeitete. Meine Bücher, fügte sie hinzu, hätten doch oft von Individuen gehandelt, die Zeiten großen gesellschaftlichen und politischen Aufruhrs erlebt hätten und dann, auf ihr Leben zurückblickend, Mühe hätten, mit ihren dunklen, beschämenden Erinnerungen fertigzuwerden. Würden sich denn auch meine künftigen Bücher auf diesem Terrain bewegen?
Ich gab eine spontane Antwort, die mich selbst überraschte. Ja, sagte ich, häufig hätte ich über Menschen geschrieben, die hin und her gerissen sind zwischen Vergessen und Erinnern. Was mich in der Zukunft aber viel mehr interessierte, sei eine Geschichte darüber, wie eine Gemeinschaft oder Nation zu ebendiesen Fragen stehe. Vergisst und erinnert sich eine Nation mehr oder minder genauso wie ein Individuum? Oder bestehen wesentliche Unterschiede? Was sind eigentlich die Erinnerungen einer Nation? Wo werden sie bewahrt? Wie werden sie geformt und gesteuert? Gibt es Zeiten, in denen Vergessen die einzige Möglichkeit ist, um einen Zyklus der Gewalt zu stoppen oder das Abgleiten einer Gesellschaft in Chaos und Krieg zu verhindern? Können andererseits stabile, freie Nationen tatsächlich auf einem Fundament vorsätzlichen Vergessens errichtet sein? Ich hörte mich der Fragerin antworten, über das alles wolle ich gern schreiben, wüsste momentan aber noch nicht, wie.
*
Eines Abends Anfang 2001 saßen Lorna und ich im abgedunkelten Wohnzimmer unseres Hauses in Nordlondon (wo wir inzwischen wohnten) und hatten eine VHS-Kassette von annehmbarer Qualität mit dem Howard-Hawks-Film Twentieth Century aus dem Jahr 1934 eingelegt. Der Titel des Films bezieht sich nicht, wie wir bald merkten, auf das eben zu Ende gegangene Jahrhundert, sondern auf den berühmten Luxuszug “20th Century Limited”, der jahrzehntelang New York mit Chicago verband. Wie manche von Ihnen vielleicht wissen, ist der Film – dessen deutsche Version nicht den Zug im Titel hat, sondern die männliche Hauptperson: Napoleon vom Broadway – eine vorwiegend im Zug angesiedelte temporeiche Komödie um einen Theaterproduzenten, der mit wachsender Verzweiflung die Hollywood-Karriere seiner wichtigsten Darstellerin zu hintertreiben und sie am Broadway zu halten versucht. Der Film lebt von der ungeheuren Komik von John Barrymore, einem der Größten seiner Zeit. Seine Mimik, seine Gesten, fast jeder Satz, den er spricht, sind mehrdeutig und überlagert von Ironie, Widersprüchen, Schrulligkeiten eines Mannes, der vor Egozentrik und Selbstdramatisierung beinahe platzt: in vieler Hinsicht eine großartige Leistung. Dennoch ließ mich der Film seltsam kalt, und daran änderte sich bis zum Schluss nichts. Anfangs wunderte ich mich. Eigentlich mochte ich Barrymore, und ich war ein großer Fan der Howard-Hawks-Filme aus dieser Zeit – His Girl Friday zum Beispiel und Only Angels Have Wings. Nachdem der Film ziemlich genau eine Stunde gelaufen war, kam mir eine ebenso simple wie verblüffende Idee. Dass mich so viele plastische, unzweifelhaft überzeugende Charaktere in Romanen, Filmen, Theaterstücken oft nicht berührten, lag daran, dass zwischen all diesen Personen keine interessante menschliche Beziehung bestand oder zustande kam. Und sofort kam mir der nächste Gedanke mit Bezug auf meine eigene Arbeit: Vielleicht sollte ich mir nicht den Kopf über meine Figuren zerbrechen, sondern über deren Beziehungen zueinander.
Während der Zug unaufhaltsam nach Westen rollte und John Barrymore zunehmend hysterisch wurde, dachte ich über E. M. Forsters berühmte Unterscheidung zwischen flachen und runden Charakteren nach. Eine literarische Figur, sagt Forster, werde dreidimensional, wenn sie “uns in überzeugender Weise zu überraschen vermag”, sie werde “rund”. Was aber, überlegte ich weiter, wenn eine Figur dreidimensional ist und ihre Beziehungen dennoch flach bleiben? An anderer Stelle derselben Vortragsreihe gebraucht Forster ein anschauliches Bild, er beschreibt, wie er die Handlung eines Romans mit einer Pinzette herauslöst und hochhält wie einen sich windenden Wurm, um ihn bei Licht zu betrachten. Konnte ich nicht, fragte ich mich, mit den diversen Beziehungen, die sich kreuz und quer durch jede Geschichte ziehen, eine ähnliche Übung vornehmen? Konnte ich es mit meiner Arbeit tun – mit beendeten Geschichten ebenso wie mit geplanten? Zum Beispiel mit einer bestimmten Lehrer-Schüler-Beziehung: Ist sie aufschlussreich, sagt sie uns etwas Neues? Oder erweist sie sich jetzt, da ich sie näher betrachte, leider als müdes Klischee, identisch mit Hunderten anderen in mittelmäßigen Geschichten? Oder eine andere Beziehung, eine zwischen zwei rivalisierenden Freunden: ist sie dynamisch? Bewirkt sie beim Leser eine empathische Resonanz? Entwickelt sie sich? Überrascht sie in überzeugender Weise? Ist sie dreidimensional? Auf einmal meinte ich besser zu verstehen, warum mir diverse Aspekte meiner Arbeit früher einfach misslungen waren, obwohl ich mich verzweifelt um Abhilfe bemüht hatte. Während ich weiter auf John Barrymore starrte, kam mir der Gedanke, dass in allen guten Geschichten, seien sie radikal oder traditionell erzählt, Beziehungen vorkommen müssen, die uns etwas bedeuten; die uns bewegen, amüsieren, ärgern, überraschen. Wenn ich in Zukunft mehr auf meine Beziehungen achte, dachte ich, werden die handelnden Personen schon allein zurechtkommen.
Dabei fällt mir ein, dass ich hier vielleicht offene Türen einrenne, weil Ihnen das alles längst klar ist. Mir jedenfalls kam der Gedanke überraschend spät in meinem Schriftstellerleben, und im Rückblick erscheint mir dieser Augenblick als Wendepunkt, vergleichbar mit den anderen, die ich Ihnen heute geschildert habe. Von nun an begann ich meine Geschichten anders zu konstruieren. Als ich zum Beispiel meinen Roman Never Let Me Go schrieb, hatte ich von Anfang an das zentrale Beziehungsdreieck im Sinn, von dem aus sich alle anderen Beziehungen auffächern.
*
Wendepunkte im Werdegang eines Schriftstellers – oder überhaupt berufliche Wendepunkte – sind so. Meist sind es unauffällige und banale Momente. Stille, private Funken der Erkenntnis. Häufig kommen sie nicht, aber wenn sie kommen, dann oft ohne Fanfaren, nicht vermittelt und sanktioniert durch Mentoren oder Kollegen. Oft müssen sie mit lauteren, scheinbar dringenderen Forderungen wetteifern. Manchmal laufen die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse aller Lebenserfahrung zuwider. Aber wenn sie da sind, muss man imstande sein, sie als das zu erkennen, was sie sind. Sonst gleiten sie einem aus den Händen.
Ich rede hier vor allem vom Kleinen und Privaten, denn das macht ja das Wesen meiner Arbeit aus: ein schreibender Mensch in einem stillen Zimmer, der versucht, mit einem anderen Menschen, einem lesenden, in einem anderen stillen – oder auch nicht so stillen – Zimmer Verbindung aufzunehmen. Geschichten können unterhalten, manchmal sind sie instruktiv, manchmal vertreten sie einen Standpunkt. Für mich besteht der Kern der Geschichte darin, dass sie Gefühle mitteilt. Dass sie anspricht, was uns Menschen über alle Grenzen und Unterschiede hinweg eint. Rund um das Erzählen sind riesige, glanzvolle Industrien entstanden, die Buchindustrie, die Filmindustrie, die Fernsehindustrie, die Theaterindustrie. Am Ende aber handeln Geschichten immer davon, dass ein Mensch zu einem anderen sagt: So empfinde ich das. Verstehst du, was ich sage? Empfindest du genauso?
*
Damit kommen wir zur Gegenwart. Kürzlich erwachte ich mit der jähen Erkenntnis, dass ich jahrelang in einer Blase gelebt hatte. Dass ich von der Frustration und den Ängsten vieler meiner Mitmenschen nichts mitbekommen hatte. Mir wurde klar, dass meine Welt – ein kultiviertes, anregendes, von ironischen, liberalen, weltoffenen Leuten bevölkertes Umfeld – in Wahrheit viel kleiner war, als ich mir je vorgestellt hätte. 2016, ein Jahr der überraschenden – und für mich deprimierenden – politischen Ereignisse in Europa und Amerika und der abscheulichen terroristischen Akte überall auf der Welt, hat mich zu der Einsicht gezwungen, dass der unaufhaltsame Vormarsch liberaler humanistischer Werte, den ich von frühester Jugend an für selbstverständlich gehalten hatte, eine Illusion war.
Ich gehöre einer Generation an, die zum Optimismus neigt, und warum auch nicht? Wir haben erlebt, wie die Generation vor uns Europa erfolgreich von einem Kontinent der totalitären Regime, der Völkermorde, der beispiellosen Massaker in einen weithin beneideten Zusammenschluss liberaler Demokratien umgewandelt hat, die fast ohne Grenzen in Freundschaft zusammenleben. Wir haben zugesehen, wie weltweit die alten Kolonialreiche zerfielen und mit ihnen die aberwitzige Anmaßung, auf der sie errichtet waren. Wir haben beträchtliche Fortschritte bei den Frauenrechten, den Schwulenrechten, im Vielfrontenkampf gegen Rassismus erlebt. Wir sind vor dem Hintergrund des ideologischen wie militärischen Kampfs zwischen Kapitalismus und Kommunismus aufgewachsen und erlebten sein Ende – ein glückliches Ende, wie viele von uns glaubten.
Wenn wir heute auf die Zeit seit dem Fall der Berliner Mauer zurückblicken, erscheint sie uns als Epoche der Selbstgefälligkeit und der vertanen Gelegenheiten. Wir haben eine gigantische Ungleichheit in der Verteilung von Vermögen und Chancen zugelassen, zwischen Nationen ebenso wie innerhalb von Nationen. Vor allem der verheerende Einmarsch in den Irak 2003 und die langen Jahre der Austeritätspolitik, die nach der skandalösen Finanzkrise 2008 dem einfachen Volk aufgezwungen wurde, haben uns in eine Gegenwart geführt, in der sich rechtsextreme Ideologien und völkische Nationalismen rasant ausbreiten. Rassismus, ob traditioneller Prägung oder in seinen moderneren, professioneller vermarkteten Erscheinungsformen, ist wieder im Kommen; unter unseren zivilisierten Straßen reckt er die Glieder wie ein erwachendes Ungeheuer, das wir begraben glaubten. Vorläufig scheint uns jede progressive, einigende Vision zu fehlen. Stattdessen zerfallen selbst die reichen Demokratien des Westens in rivalisierende Lager, die erbittert um Macht und Ressourcen streiten.
Und vor der Tür stehen – oder sind sie schon da? – die Herausforderungen durch bahnbrechende Neuerungen in den Naturwissenschaften, der Technologie, der Medizin. Neue Gentechniken wie die Genom-Editierung durch die CRISPR/Cas-Methode und die Fortschritte bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und der Robotertechnik werden revolutionäre, potenziell lebensrettende Veränderungen bewirken; zugleich aber können sie zu brutaler Elitenbildung führen, praktisch einer neuen Apartheid, und massive Arbeitslosigkeit nach sich ziehen, von der auch die aktuellen beruflichen Eliten nicht verschont bleiben werden.
Und ich, ein Mann in den Sechzigern, stehe hier, reibe mir die Augen und versuche im Nebel die Umrisse einer Welt zu erkennen, von deren Existenz ich bis gestern nichts ahnte. Werde ich, ein müder Autor einer intellektuell müden Generation, jetzt die Energie aufbringen, um mir dieses Neuland genau anzusehen? Habe ich noch etwas zu bieten, das Perspektiven öffnen kann, das den Auseinandersetzungen, Kämpfen und Kriegen, die mit der Anpassung der Gesellschaften an die gewaltigen Veränderungen zwangsläufig einhergehen, emotionale Facetten hinzufügt?
Ich werde weitermachen, werde es so gut machen müssen, wie ich kann. Weil ich nach wie vor glaube, dass die Literatur wichtig ist, umso mehr, wenn wir auf dem Weg durch dieses schwierige Terrain sind. Aber ich baue auf die Schriftsteller der nachfolgenden Generationen, die uns inspirieren und Wege weisen werden. Das ist jetzt ihre Zeit; sie werden das nötige Wissen haben und das Gespür dafür, das mir fehlt. In der Literatur, im Film, im Fernsehen, im Theater sehe ich heute verwegene und spannende Talente: Frauen und Männer in den Vierzigern, Dreißigern und Zwanzigern. Daher bin ich optimistisch. Warum denn nicht?
Aber lassen Sie mich mit einem Appell enden – meinem Nobel-Appell, wenn Sie so wollen. Die ganze Welt retten wird schwer sein, aber wir wollen wenigstens darüber nachdenken, wie wir unseren kleinen Winkel bereiten, den Winkel der “Literatur”, in dem wir Bücher lesen, schreiben, publizieren, empfehlen, brandmarken und mit Preisen auszeichnen. Wenn wir in dieser ungewissen Zukunft eine nennenswerte Rolle spielen, wenn wir von den Schriftstellern von heute und von morgen das Beste haben wollen, dann, glaube ich, müssen wir vielfältiger werden. Das meine ich vor allem in zweierlei Hinsicht.
Erstens müssen wir unsere gewohnte literarische Welt über die Komfortzonen der Erste-Welt-Elite hinaus ausweiten und viel mehr Stimmen hereinholen. Wir müssen nachdrücklicher und energischer versuchen, die Edelsteine in den uns heute noch unbekannten literarischen Kulturen zu finden, seien sie in fernen Ländern oder vor unserer Haustür. Zweitens: Wir müssen sehr darauf achten, dass wir unsere Definitionen davon, was gute Literatur sein soll, nicht zu eng stecken, nicht zu konservativ formulieren. Auch die nächste Generation wird uns wichtige und wunderbare Geschichten erzählen, aber sie wird mit allen möglichen neuen, womöglich verwirrenden Erzählformen aufwarten. Wir müssen wach und offen bleiben, besonders was Genre und Form betrifft, um ihr Bestes zu fördern und zu feiern. Gerade in einer Zeit gefährlich um sich greifender Spaltung müssen wir zuhören. Gute Literatur – geschrieben und gelesen – wird Barrieren einreißen. Es könnte sich sogar eine neue Idee finden, eine große humane Vision, der wir uns anschließen.
Der Schwedischen Akademie, der Nobelstiftung und dem Volk von Schweden, die über viele Jahrzehnte hinweg aus dem Nobelpreis ein strahlendes Symbol für das Gute gemacht haben, nach dem wir Menschen streben, – ihnen sage ich meinen Dank.
1. Dt. Damals in Nagasaki, 1984. Übersetzung: Margarete Längsfeld.
2. Dt. Was vom Tage übrigblieb, 1990. Übersetzung: Hermann Stiehl.
3. “Sein Mädchen für besondere Fälle”, 1940
4. “S.O.S. Feuer an Bord”, 1939
5. E. M. Forster, Ansichten des Romans, Frankfurt/M 1949, S. 88. Übersetzung: Walter Schürenberg.
6. Alles, was wir geben mussten, 2005. Übersetzung: Barbara Schaden.
Übersetzung: Barbara Schaden
Copyright © The Nobel Foundation 2017
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.