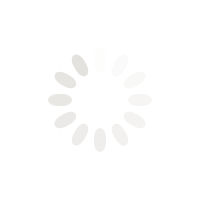Imre Kertész – Nobelvorlesung

Imre Kertész.
English
Swedish
French
German
Hungarian
Hungarian (pdf)
Heureka!
Zunächst bin ich Ihnen ein Geständnis schuldig, ein wahrscheinlich sonderbares, aber aufrichtiges Geständnis. Spätestens seit ich das Flugzeug bestiegen habe, um hier in Stockholm den diesjährigen Nobelpreis für Literatur entgegenzunehmen, spüre ich unausgesetzt den durchdringenden Blick eines nüchternen Beobachters in meinem Nacken, und in diesem feierlichen Moment, der mich plötzlich in den Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit stellt, fühle ich mich eher mit diesem kühlen Beobachter identisch als mit dem auf einmal weltweit gelesenen Autor. Es bleibt nur zu hoffen, daß die Rede, die ich bei diesem ehrenvollen Anlaß halten darf, mir eine Hilfe sein wird, diesen Zwiespalt aufzuheben und diese beiden in mir lebenden Personen am Ende doch noch zu vereinen.
Vorerst ist mir selbst nicht vollkommen klar, welcher Art die Aporie ist, die ich zwischen dieser hohen Auszeichnung und meinem Werk beziehungsweise meinem Leben empfinde. Vielleicht habe ich allzu lange in der Diktatur gelebt, in einer mir feindlichen, hoffnungslos fremden geistigen Umgebung, als daß ich mir ein gewisses Selbstbewußtsein als Schriftsteller hätte aneignen können: Es war müßig, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Überdies gab man mir von allen Seiten zu verstehen, daß das, worüber ich schreibe, das sogenannte “Thema”, das mich beschäftigt, unzeitgemäß und nicht attraktiv sei. Deshalb, und da es mit meiner eigenen Überzeugung zusammenfiel, habe ich also das Schreiben immer als meine strikte Privatangelegenheit aufgefaßt.
Privatangelegenheit: das schließt Ernsthaftigkeit natürlich nicht aus, auch wenn eine derartige Ernsthaftigkeit ein wenig lächerlich erscheint in einer Umgebung, in der einzig die Lüge ernst genommen wird. Dort hieß das philosophische Axiom, die Welt ist die unabhängig von uns existierende, objektive Realität. Ich dagegen kam an einem schönen Frühlingstag 1955 unvorhergesehen auf den Gedanken, daß nur eine einzige Realität existiert, diese Realität aber bin ich selbst, mein Leben, dieses zerbrechliche und mir für unbestimmte Zeit zugesprochene Geschenk, das unbekannte, fremde Mächte beschlagnahmt, verstaatlicht, determiniert und besiegelt hatten und das ich aus der sogenannten Geschichte, diesem fürchterlichen Moloch, zurückholen mußte, weil es allein mir gehört und ich entsprechend mit ihm umzugehen hatte.
Das stand auf jeden Fall in radikalem Gegensatz zu allem, was um mich herum, wenn auch nicht objektive, so doch unanfechtbare Realität war. Ich spreche vom kommunistischen Ungarn, dem „blühenden und gedeihenden” Sozialismus. Wenn die Welt eine unabhängig von uns existierende, objektive Realität ist, ist der Mensch – auch für sich selbst – nichts anderes als ein Objekt und seine Lebensgeschichte eine zusammenhangslose Reihe von historischen Zufällen, über die er sich zwar wundern kann, mit denen er jedoch selbst nichts zu tun hat. Sie zu einem zusammenhängenden Ganzen zu verknüpfen, ist zwecklos, denn es finden sich Momente darin, die viel zu objektiv sind, als daß sein subjektives Ich die Verantwortung dafür übernehmen könnte.
Ein Jahr später, 1956, brach die ungarische Revolution aus. Für einen Augenblick wurde das Land subjektiv. Doch die sowjetischen Panzer stellten die Objektivität rasch wieder her.
Sollte Ihnen das ironisiert erscheinen, dann bitte ich Sie zu bedenken, was aus der Sprache, aus den Wörtern im zwanzigsten Jahrhundert geworden ist. Wahrscheinlich ist es für den heutigen Schriftsteller eine der ersten und erschütterndsten Entdeckungen, daß die Sprache, so wie sie ist, quasi aus einer vor unserer Zeitrechnung liegenden Kulturepoche überkommen, einfach untauglich zur Darstellung der wirklichen Prozesse und einstmals einhelliger Vorstellungen ist. Denken Sie an Kafka, an Orwell, in deren Händen die alte Sprache einfach zerfällt, als hätten sie sie gleichsam im Feuer gewendet, um dann ihre Asche vorzuweisen, in der neue und bisher unbekannte Formen zum Vorschein kommen.
Doch ich möchte auf meine strikte Privatangelegenheit, das Schreiben, zurückkommen. Es gibt da einige Fragen, die man sich in meiner Situation gar nicht erst stellt. Sartre zum Beispiel hat einer von ihnen ein ganzes Büchlein gewidmet: „Für wen schreiben wir?” Die Frage ist interessant, doch sie kann auch gefährlich sein, und ich jedenfalls bin dem Schicksal dankbar, daß ich niemals über sie nachdenken mußte. Lassen Sie uns sehen, worin die Gefahr besteht. Wenn wir uns zum Beispiel eine gesellschaftliche Schicht wählen, die wir nicht nur delektieren, sondern auch beeinflussen wollen, haben wir als erstes unseren eigenen Stil zu prüfen, ob er wirklich geeignet ist, die erstrebte Wirkung auszuüben. Den Schriftsteller kommen bald Zweifel an: Das Schlimme ist, er wird in jedem Fall damit beansprucht sein, sich selbst zu observieren. Und woher sollte er auch wissen, welche Wünsche sein Publikum tatsächlich hat, was ihm gefällt? Letzten Endes kann er nicht jeden Einzelnen befragen. Im übrigen würde er es auch vergebens tun. Er kann nur davon ausgehen, wie er sich dieses bestimmte Publikum vorstellt, welche Ansprüche er ihm unterstellt und was auf ihn jene Wirkung ausüben würde, die er erreichen möchte. Für wen also schreibt der Schriftsteller? Die Antwort ist offenkundig: für sich selbst.
Von mir kann ich zumindest sagen, daß ich ohne jeden Umweg zu dieser Antwort gekommen bin. Sicher, die Sache war einfacher: Ich hatte kein Publikum, und ich wollte auch niemand beeinflussen. Ich begann nicht aus einer bestimmten Zweckdienlichkeit heraus zu schreiben, und was ich schrieb, richtete sich an niemand. Wenn mein Schreiben irgendein ausdrückliches Ziel hatte, dann bestand es aus nichts anderem als der formalen und sprachlichen Treue zum Gegenstand. Es war wichtig, das in der lächerlichen, aber traurigen Epoche der staatlich gelenkten und sogenannten engagierten Literatur zu klären.
Schon schwerer könnte ich die nicht ohne jeden berechtigten Zweifel gestellte Frage beantworten, warum wir schreiben. Auch darin hatte ich Glück, denn es bot sich noch nicht einmal an, daß ich in dieser Frage hätte wählen können. Wie das kam, habe ich im übrigen in meinem Roman „Fiasko” wirklichkeitsgetreu beschrieben. Ich stand auf dem menschenleeren Flur eines Amtsgebäudes, und es passierte nicht mehr, als daß ich vom Quergang her dumpfe Schritte vernahm. Eine sonderbare Erregung überkam mich, zumal die Schritte immer näher zu mir herankamen, und obwohl sie nur von einer einzigen, unsichtbaren Person stammten, ergriff mich plötzlich das Gefühl, als vernähme ich die Schritte Hunderttausender. Es war, als würde eine Marschkolonne herankommen, mit dröhnendem Schritt, und ich begriff mit einem Mal, welche Sogkraft von dieser Kolonne, diesen dröhnenden Schritten ausging. Dort, auf jenem Flur, wurde mir innerhalb einer einzigen Minute der Rausch der Selbstaufgabe klar, die trunkene Lust, sich in der Masse zu verlieren, das, was Nietzsche – freilich in anderem Zusammenhang, aber dennoch auch hier zutreffend – das dionysische Erlebnis genannt hat. Eine fast physische Kraft drängte und zog mich in diese Reihen, ich hatte das Gefühl, ich müßte mich gegen die Wand lehnen und dort ducken, um diesem verführerischen Sog zu widerstehen.
Ich berichte diesen intensiven Augenblick so, wie ich ihn erlebt habe; als ob sich die Quelle, aus der er visionsartig hervorbrach, irgendwo außerhalb meiner und nicht in mir befände. Jeder Künstler kennt solche Augenblicke. Früher nannte man sie plötzliche Eingebung. Doch was ich erlebte, würde ich nicht zu den Erlebnissen künstlerischer Art zählen. Vielmehr würde ich es als existentielle Bewußtwerdung bezeichnen. Dieser Augenblick gab mir nicht meine Kunst in die Hand, nach deren Mitteln ich noch lange suchen mußte, sondern mein Leben, das ich fast schon verloren hatte. Er kündete von Einsamkeit, einem schwierigeren Leben, von dem, worüber ich am Anfang gesprochen habe: dem Heraustreten aus dem berauschenden Marsch, aus der Geschichte, die uns Persönlichkeit und Schicksal raubt. Bestürzt erkannte ich, daß mir nach einem Jahrzehnt, da ich aus den Konzentrationslagern der Nazis zurückgekehrt war, und noch halb im Bann des stalinistischen Terrors, von dem Ganzen nicht mehr als ein nebulöser Eindruck und ein paar Anekdoten blieben. Als wenn mir nichts passiert sei, wie man zu sagen pflegt.
Es ist offenkundig, daß solche visionären Momente ihre eigene, lange Vorgeschichte haben; Freud würde sie vermutlich aus der Verdrängung eines traumatischen Erlebnisses herleiten. Wer weiß, ob er damit nicht recht hätte. Da ich auch selbst eher zu Rationalität neige und mir jede Art von Mystizismus oder Schwärmerei fernliegt, muß ich also, wenn ich von Vision spreche, darunter doch etwas Reales verstehen, das eine übernatürliche Form angenommen hat; die plötzliche, gewissermaßen revolutionäre Offenbarung eines in mir gereiften Gedankens, etwas, das in dem uralten Ausruf „heureka!” zum Ausdruck kommt. „Ich habe es gefunden!” Doch was hatte ich gefunden?
Ich habe an anderer Stelle einmal gesagt, der sogenannte Sozialismus habe für mich das gleiche bedeutet wie für Marcel Proust die in den Tee getunkte Madeleine-Hostie, die plötzlich den Geschmack vergangener Zeiten in ihm wiedererweckte. In erster Linie auf sprachliche Erwägungen gegründet, habe ich mich nach der niedergeschlagenen Revolution von 1956 entschlossen, in Ungarn zu bleiben. Diesmal konnte ich also mit erwachsenen Augen – und nicht wie einst als Kind – beobachten, wie eine Diktatur funktioniert. Ich sah, wie ein Volk dazu gebracht wurde, seine Vorstellungen zu verleugnen, sah die ersten, vorsichtigen Gesten der Anpassung, begriff, daß die Hoffnung ein Instrument des Bösen ist und Kants kategorischer Imperativ, die Ethik, nur eine fügsame Dienstmagd der Selbsterhaltung.
Ist eine größere Freiheit vorstellbar, als sie der Schriftsteller in einer relativ moderaten, sagen wir müden, ja, dekadenten Diktatur genießt? In den sechziger Jahren hatte die ungarische Diktatur einen Zustand der Konsolidierung erreicht, den man fast als einen gesellschaftlichen Konsens bezeichnen könnte und dem die westliche Welt später mit heiterer Nachsichtigkeit den Kosenamen „Gulaschkommunismus” gab: nach anfänglichem Groll schien der ungarische Kommunismus mit einem Mal der Lieblingskommunismus des Westens geworden zu sein. Im tiefen Morast dieses Konsenses gab man den Kampf entweder endgültig auf oder fand verschlungene Wege, die in die innere Freiheit führten. Die Grundkosten des Schriftstellers sind niedrig, zur Ausübung seines Handwerks genügen Papier und Bleistift. Der Ekel und die Depression, mit denen ich allmorgendlich aufwachte, stimmten mich auf der Stelle auf die Welt ein, die ich darstellen wollte. Ich mußte gewahr werden, daß ich den unter der Logik des Totalitarismus stöhnenden Menschen in einem anderen Totalitarismus darstellte, und unzweifelhaft machte das aus der Sprache, in der ich meinen Roman schrieb, ein suggestives Medium. Wenn ich meine damalige Situation ganz ehrlich ermesse, weiß ich nicht, ob ich im Westen, in einer freien Gesellschaft, fähig gewesen wäre, den Roman zu schreiben, den die Welt heute unter dem Titel „Roman eines Schicksallosen” kennt und dem die höchste Anerkennung der Schwedischen Akademie zuteil wird.
Nein, ganz sicher hätte sich mein Bemühen auf etwas anderes gerichtet. Ich behaupte nicht, daß es nicht auch die Wahrheit gewesen wäre, doch vielleicht eine andere Art Wahrheit. Auf dem freien Markt der Bücher und Gedanken hätte vielleicht auch ich mir den Kopf über eine etwas spektakulärere Romanform zerbrochen: Zum Beispiel hätte ich die erzählte Zeit zerstückeln können, um nur die wirkungsvollen Szenen darzustellen. Nur daß mein Romanheld in den Konzentrationslagern nicht seine eigene Zeit lebt, weil er weder im Besitz seiner Zeit, noch seiner Sprache, noch seiner Persönlichkeit ist. Er legt nicht Erinnerungen vor, er existiert. So mußte der Arme also in den obskuren Schlingen der Linearität schmachten und konnte sich nicht von den qualvollen Einzelheiten befreien. Statt einer ansehnlichen Reihe großer tragischer Momente mußte er das Ganze durchleben, das bedrückend ist und wenig Abwechslung bietet, so wie das Leben.
Das führte jedoch zu überraschenden Lehren. Die Linearität verlangte, die vorgegebenen Situationen vollständig auszufüllen. Sie erlaubte nicht, eine Zeit von, sagen wir, zwanzig Minuten elegant zu überspringen, einfach, weil diese zwanzig Minuten wie ein unbekanntes und erschreckendes schwarzes Loch vor mir klafften, so wie ein Massengrab. Ich spreche von jenen zwanzig Minuten, die an der Verladerampe des Vernichtungslagers Birkenau vergingen, bis die aus dem Zug gestiegenen Menschen vor den Offizier gelangten, der die Selektion vornahm. Im großen und ganzen erinnerte ich mich an diese zwanzig Minuten, aber der Roman verlangte von mir, meiner Erinnerung nicht zu trauen. Doch wie viele Berichte, Aussagen, Erinnerungen von Überlebenden ich auch las, sie stimmten fast sämtlich darin überein, daß alles sehr schnell und unübersichtlich abgelaufen sei: Die Waggontüren wurden aufgerissen, sie vernahmen Gebrüll und Hundegebell, die Frauen und Männer wurden voneinander getrennt, in diesem wilden Durcheinander gelangten sie vor einen Offizier, der sie mit einem raschen Blick in Augenschein nahm und mit ausgestrecktem Arm auf etwas zeigte, und kurz darauf fanden sie sich in Häftlingskleidung wieder.
Ich hatte diese zwanzig Minuten anders in Erinnerung. Nach authentischen Quellen suchend, las ich zum ersten Mal die klaren, selbstquälerisch gnadenlosen Erzählungen Tadeusz Borowskis, darunter „Bitte, die Herrschaften zum Gas!”. Später kam mir die Foto-Serie in die Hände, die ein SS-Soldat von den an der Rampe von Birkenau ankommenden Menschentransporten gemacht hatte und die von amerikanischen Soldaten in der ehemaligen SS-Kaserne des schon befreiten Lagers Dachau gefunden worden war. Bestürzt betrachtete ich die Bilder. Hübsche, lachende Frauengesichter, verständnisvoll dreinblickende junge Männer, voll von den besten Absichten, von der Bereitschaft zur Mitarbeit. Nun verstand ich, warum und wie diese beschämenden zwanzig Minuten der Untätigkeit und Wehrlosigkeit sich in ihnen so hatten verwischen können. Und als ich darüber nachsann, daß sich das alles immer wieder genauso wiederholt hatte, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, eine lange Reihe von Jahren hindurch, da erkannte ich die Technik des Schreckens, begriff, wie es möglich gewesen war, die menschliche Natur selbst gegen das Leben des Menschen zu wenden.
So habe ich mich, Schritt für Schritt, auf dem linearen Weg der Erkenntnisse voranbewegt; wenn Sie so wollen, war das meine heuristische Methode. Rasch sah ich ein, daß mich nicht im geringsten interessierte, für wen ich schrieb, und auch nicht, warum ich schrieb. Mich interessierte nur eine Frage: Was hatte ich überhaupt noch mit der Literatur zu tun? Denn das war klar, von der Literatur und von dem Geist, den Ideen, die mit diesem Begriff verbunden sind, trennte mich eine unübertretbare Demarkationslinie, und diese Demarkationslinie trug – wie so vieles andere auch – den Namen Auschwitz. Wenn jemand über Auschwitz schreibt, muß ihm klar sein, daß Auschwitz die Literatur – wenigstens in einem bestimmten Sinn – aufhebt. Über Auschwitz kann man nur einen schwarzen Roman schreiben, einen, mit allem Respekt gesagt: Kolportageroman in Fortsetzungen, der in Auschwitz beginnt und bis zum heutigen Tag dauert. Womit ich sagen will, daß seit Auschwitz nichts geschehen ist, was Auschwitz aufgehoben, was Auschwitz widerlegt hätte. Der Holocaust konnte in meinem Werk niemals in der Vergangenheitsform erscheinen.
Man pflegt über mich zu sagen – und das ist mal als Lob und mal als Tadel gemeint – daß ich nur ein Thema habe: daß ich ein Schriftsteller des Holocaust sei. Dagegen habe ich nichts einzuwenden; weshalb sollte ich – von gewissen Einschränkungen abgesehen – diesen mir zugewiesenen Platz in den dafür vorgesehenen Regalen der Bibliotheken nicht einnehmen? Welcher Schriftsteller ist heute nicht Schriftsteller des Holocaust? Ich verstehe das so, daß der Holocaust nicht direkt zum Thema gewählt sein muß, damit man auf den gebrochenen Ton aufmerksam wird, der die moderne Kunst Europas seit Jahrzehnten beherrscht. Ich gehe noch weiter: ich kenne überhaupt keine wirklich gute, authentische Kunst, in der ich nicht einen solchen Bruch spüren würde, gewissermaßen als blicke man nach einer Nacht voller Alpträume zerschlagen und ratlos in der Welt umher. Ich habe nie versucht, den als Holocaust bezeichneten Problemkreis als so etwas wie einen unaufhebbaren Konflikt zwischen Deutschen und Juden zu betrachten; ich habe nie geglaubt, er sei etwa das jüngste Kapitel der jüdischen Leidensgeschichte, das logisch auf die vorangegangenen Prüfungen gefolgt ist; ich habe ihn nie als sogenannten einmaligen Ausrutscher der Geschichte gesehen, als ein in seiner Dimension alle früheren übersteigendes Pogrom, als die Vorbedingung für die Entstehung des jüdischen Staates. Ich habe im Holocaust die Situation des Menschen erkannt, die Endstation des großen Abenteuers, an der der europäische Mensch nach zweitausend Jahren ethischer und moralischer Kultur angekommen ist.
Uns bleibt jetzt zu überlegen, wie wir von hieraus weiterfinden. Das Problem Auschwitz besteht nicht darin, ob wir sozusagen einen Schlußstrich darunter ziehen oder nicht; ob wir es im Gedächtnis bewahren sollten oder in der entsprechenden Schublade der Geschichte versenken; ob wir für die Millionen von Ermordeten Mahnmale errichten und wie sie beschaffen sein sollten. Das wirkliche Problem Auschwitz besteht darin, daß es geschehen ist und daß wir an dieser Tatsache mit dem besten, aber auch mit dem schlechtesten Willen nichts ändern können. Der katholische ungarische Dichter János Pilinszky hat diese schwierige Situation vielleicht am genauesten bezeichnet, als er sie einen „Skandal” nannte; und damit meinte er ganz offenkundig die Tatsache, daß Auschwitz sich im christlichen Kulturkreis ereignet hat und somit für den metaphysischen Geist unverwindbar ist.
Alte Prophezeiungen sprechen davon, daß Gott tot sei. Zweifellos ist, daß wir uns nach Auschwitz selbst überlassen sind. Wir müssen uns unsere Werte selbst erschaffen, Tag für Tag und durch jenes andauernde, aber unsichtbare ethische Wirken, das diese Werte eines Tages ans Licht bringt und vielleicht zu einer neuen europäischen Kultur erhebt. Den Preis, mit dem die Schwedische Akademie gerade mein Werk auszuzeichnen für richtig befand, betrachte ich als ein Zeichen dafür, daß Europa erneut jener Erfahrungen bedarf, die die Zeugen von Auschwitz, des Holocaust, zu machen gezwungen waren. In meinen Augen zeugt das, erlauben Sie mir das zu sagen, von Mut, in gewisser Hinsicht sogar von Entschlossenheit; Sie haben ja gewünscht, daß ich hier erscheine, obwohl Sie ahnen mußten, was Sie von mir hören würden. Wie auch immer, das, was in der Endlösung und dem „Universum der Konzentrationslager” seinen Ausdruck gefunden hat, kann nicht mißverstanden werden, und die einzige Möglichkeit, zu überleben und uns schöpferische Kraft zu wahren, besteht darin, daß wir diesen Nullpunkt erkennen. Warum sollte diese Klarsicht nicht fruchtbar sein? In der Tiefe großer Erkenntnisse, selbst wenn sie sich auf unüberwindbare Katastrophen gründen, steckt immer etwas vom großartigsten aller europäischen Werte, ein Moment der Freiheit, das als Surplus, als etwas Bereicherndes in unser Leben eingeht, indem es uns die wahre Tatsache unserer Existenz und unsere wahre Verantwortung für sie zu Bewußtsein bringt.
Es ist mir eine besondere Freude, diese Gedanken in meiner Muttersprache, auf Ungarisch vortragen zu können. Ich bin in Budapest geboren, in einer jüdischen Familie, deren mütterlicher Zweig aus dem siebenbürgischen Klausenburg und deren väterlicher aus der südwestlichen Ecke der Balatongegend stammt. Meine Großeltern zündeten am Freitagabend, zum Sabbatbeginn, noch Kerzen an, ihre Namen aber waren schon ungarisiert, und es war ihnen selbstverständlich, das Judentum als ihren Glauben, Ungarn jedoch als ihre Heimat anzusehen. Meine Großeltern mütterlicherseits fanden im Holocaust den Tod, die Großeltern väterlicherseits hat das kommunistische Rákosi-Regime umgebracht, als es das jüdische Altersheim von Budapest in die nördliche Grenzregion des Landes zwangsumsiedelte. Für mich enthält und symbolisiert diese kurze Familiengeschichte gleichsam die jüngste Leidensgeschichte des Landes. Ich lernte aus alledem, daß die Trauer nicht nur Bitterkeit, sondern auch außerordentliche moralische Reserven birgt. Jude zu sein: das empfinde ich heute in erster Linie wieder als eine moralische Aufgabe. Wenn der Holocaust inzwischen Kultur-schaffend wirkt – und das ist unleugbar der Fall -, so kann er das allein mit dem Ziel, aus der nicht wieder gut zu machenden Wirklichkeit auf dem Wege des Geistes Wiedergutmachung, Katharsis zu zeugen.
Zum Ende meiner Rede kommend, muß ich ehrlich bekennen, daß ich auch jetzt noch kein richtiges Gleichgewicht zwischen meinem Leben, meinem Werk und dem Nobelpreis gefunden habe. Vorerst empfinde ich nur tiefe Dankbarkeit – Dankbarkeit für die Liebe, die mich gerettet hat und noch heute am Leben hält. Doch man wird zugeben müssen, daß an dieser kaum noch nachzuvollziehenden Laufbahn, an dieser, wenn ich so sagen darf, „Karriere” – der meinigen – etwas Verstörendes, Absurdes ist; etwas, das sich kaum zu Ende denken läßt, ohne daß man von der Versuchung erfaßt wird, an eine jenseitige Ordnung, an Vorsehung oder eine metaphysische Gerechtigkeit zu glauben: das heißt, ohne daß man in die Falle der Selbsttäuschung tappt und damit scheitert, kaputt geht und die tiefe und quälende Verbindung zu den Millionen verliert, die vernichtet worden sind und die Gnade nie erfahren haben. Es ist nicht so einfach, Ausnahme zu sein; und wenn uns das Schicksal zur Ausnahme bestimmt hat, müssen wir uns aussöhnen mit der absurden Ordnung des Zufalls, die mit der Willkür eines Erschießungskommandos über unser unmenschlichen Mächten und grausamen Diktaturen ausgesetztes Leben herrscht.
Doch hat sich, während ich mich auf diese Rede vorbereitete, etwas ganz Sonderbares zugetragen, das meine Ruhe in einer bestimmten Hinsicht dann doch wiederhergestellt hat. Eines Tages brachte mir die Post einen großen braunen Umschlag. Er kam vom Direktor der Gedenkstätte Buchenwald, Dr. Volkhard Knigge. Seinen herzlichen Glückwünschen hatte er einen kleineren Umschlag beigefügt und dessen Inhalt vorab erklärt, damit ich, falls ich eventuell nicht die Kraft dazu hätte, mich nicht mit ihm konfrontiere. In dem Umschlag fand sich nämlich eine Kopie der Tagesmeldung über den Häftlingsbestand des Konzentrationslagers Buchenwald am 18. Februar 1945. Unter der Rubrik „Abgänge” erfuhr ich darin vom Tod des Häftlings Vierundsechzigtausendneunhunderteinundzwanzig, Imre Kertész, geboren 1927, Jude, Fabrikarbeiter. Die beiden falschen Angaben: die über mein Geburtsjahr und meinen Beruf, waren deshalb hineingeraten, weil ich bei der Aufnahme in die Administration von Buchenwald angegeben hatte, zwei Jahre älter zu sein, um nicht unter die Kinder eingereiht zu werden, und Fabrikarbeiter statt Schüler, um brauchbarer zu erscheinen.
Einmal bin ich also schon gestorben, um leben zu dürfen – und vielleicht ist dies meine wahre Geschichte. Wenn es sich so verhält, dann widme ich das aus diesem Kindertod geborene Werk den vielen Millionen Toten und allen denen, die sich heute noch dieser Toten erinnern. Doch da es sich letzten Endes um Literatur handelt, eine Literatur, die der Begründung Ihrer Akademie zufolge zugleich Zeugnis ist, mag es vielleicht auch für die Zukunft von Nutzen sein, ja, am liebsten würde ich sagen: möge es der Zukunft dienen. Denn nach meiner Auffassung stoße ich, wenn ich mich mit der traumatischen Wirkung von Auschwitz auseinandersetze, auf die Grundfragen der Lebensfähigkeit und kreativen Kraft des heutigen Menschen; das heißt, über Auschwitz nachdenkend, denke ich paradoxerweise vielleicht eher über die Zukunft nach als über die Vergangenheit.
Übersetzung : Kristin Schwamm
Bearbeitung : Ingrid Krüger
Nobel Prizes and laureates
Six prizes were awarded for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. The 14 laureates' work and discoveries range from quantum tunnelling to promoting democratic rights.
See them all presented here.